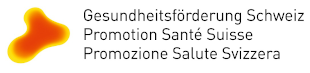News
-
Mittwoch, 14. Januar 2026
Ihre Erfahrungen werden gesucht
BFH startet Studie zu Angststörungen & Depressionen rund um die Mutterschaft
Prämenstruelles Syndrom
20-50% der Frauen im gebärfähigen Alter leiden an einem Prämenstruellen Syndrom. Bei etwa 5% sind die Beschwerden so ausgeprägt, dass sie medikamentös behandelt werden müssen. Betroffene haben in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus und insbesondere vor Beginn der Menstruation Beschwerden, die denen einer postnatalen Depression gleichen: Traurigkeit, Ängstlichkeit, innere Anspannung, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Teilnahmslosigkeit, Konzentrationsprobleme, Erschöpftheit, Appetitschwankungen, Schlafprobleme und diffuse Schmerzen. Auch beim Prämenstruellen Syndrom geht man davon aus, dass die Hormone eine Rolle spielen, dass aber mehrere Ursachen zusammenkommen müssen. Als weitere mögliche Ursachen gelten Stress, Ernährungs- und Lebensstil und eine genetische Veranlagung zu psychischen Krankheiten. Nach einer Geburt kann sich ein Prämenstruelles Syndrom verstärken.
Die ähnlichen Symptome und Ursachen legen nahe, dass Frauen, die an einem Prämenstruellen Syndrom leiden, oft auch an einer postnatalen Depression erkranken und umgekehrt. Tatsächlich scheint es Frauen zu geben, die empfindlicher auf Hormonschwankungen reagieren. Frauen mit Prämenstruellem Syndrom weisen damit einen Risikofaktor für postnatale Depression auf, was aber nicht heisst, dass es tatsächlich nach einer Geburt zur Erkrankung kommen muss. Umgekehrt stellen depressive Frauen manchmal fest, dass ihre Stimmung vom Monatszyklus beeinflusst wird. Das Phänomen kann nach Abklingen der Depression auch wieder verschwinden.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie unter einem Prämenstruellen Syndrom leiden, sollten Sie ein Stimmungstagebuch führen. Notieren Sie über mehrere Monate täglich Ihr Befinden und jeweils den Beginn Ihrer Menstruation. Das Stimmungstagebuch zeigt Ihnen, ob Ihre Stimmung tatsächlich vom Menstruationszyklus abhängt, und es ist eine wichtige Information für die Ärztin, wenn Sie Ihre Beschwerden medizinisch abklären möchten.
Was ist durch die Krankenkasse gedeckt?
Die Krankenkasse übernimmt grundsätzlich nur Leistungen, wenn von einem Arzt eine Krankheit diagnostiziert wurde – mit Ausnahme gewisser Präventivbehandlungen. Im Zweifelsfall lohnt es sich immer, vorgängig bei der Krankenkasse abzuklären, ob eine geplante Behandlung durch die Grundversicherung oder eine allfällige Zusatzversicherung gedeckt wird. Gerade bei den Zusatzversicherungen weicht die Praxis der einzelnen Krankenkassen stark voneinander ab.
Die hier gemachten Angaben sind ohne Gewähr!
| Behandlung | Grundversicherung | Zusatzversicherung |
|---|---|---|
| Akupunktur | nur bei Ausführung durch einen Arzt | evtl. |
| Allgemeinpraktikerin | ja | - |
| Atemtherapie | nein | evtl. |
| Ayurveda | nein | evtl. |
| Babymassage-Kurs | nein | evtl. |
| Bachblütentherapie | nein | evtl. |
| Cranio-Sakral-Therapie | nein | evtl. |
| Ernährungsberatung | auf ärztliche Anordnung hin bei Stoffwechselkrankheiten, bei Adipositas (BMI über 30) und Folgeerkrankungen des Übergewichts oder in Kombination mit dem Übergewicht, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei Krankheiten des Verdauungssystems, bei Nierenerkrankungen, bei Fehl- sowie Mangelernährungszustände, bei Nahrungsmittelallergien oder allergische Reaktionen auf Nahrungsbestandteile | evtl. |
| Gynäkologin | ja | - |
| Haushalthilfe, Spitex | nein | evtl. |
| Hormonbehandlung | in der Regel ja | - |
| Kinesiologie | nein | evtl. |
| Kurse in Yoga, Tai Chi, progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, autogenes Training usw. | nein | evtl. |
| Lichttherapie | Kauf oder Miete der Lampe nur bei saisonaler Depression | evtl. |
| Medikamente | in der Regel ja | - |
| Mütterberatung | Mütterberatung ist in der Regel kostenlos | - |
| Paarberatung, Familienberatung | nein | nein |
| Phytotherapie | nur Medikamente, die auf der Arzneimittelliste stehen (z.B. Johanniskrautpräparate) | evtl. |
| Psychiatrische Spitex | ja | nein |
| Psychotherapie durch Psychiaterin | bei diagnostizierter Krankheit | nein |
| Psychotherapie durch Psychologin | wenn die Psychologin bei einem Arzt angestellt ist (sog. delegierte Therapie): ja | Kostenanteil bei entsprechender Zusatzversicherung, für Psychotherapeuten FSP, SPV, SBAP und wenn eine ärztliche Anordnung vorliegt |
| Reiki | nein | evtl. |
| Shiatsu | nein | evtl. |
| Stationäre Behandlung (inkl. Mutter-Kind-Plätze) | Aufenthalt der Mutter, wenn es sich um einen anerkannten Leistungserbringer handelt: ja; muss vorgängig abgeklärt werden. Der Aufenthalt des Kindes muss in der Regel selber bezahlt werden. | - |
| Stillberatung | 3 Sitzungen nach der Geburt, sofern sie von einer Hebamme oder einer spezialisierten Krankenschwester durchgeführt werden | nein |
| Therapie mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen | in der Regel ja | - |
Weitere Therapieformen
Hormon-Therapie
Grundsätzlich ist die Überprüfung des Hormonspiegels bei depressiven Frauen empfehlenswert. Eine Behandlung mit Hormonen ist aber nur angezeigt, wenn ein eklatanter Hormonmangel oder -überfluss vorliegt. Beispiele dafür sind Mangel an Östrogenen oder Progesteron, eine Überproduktion von Prolaktin oder eine Über- oder Unterproduktion des Schilddrüsenhormons.
Bei der Depressionsbehandlung gab es mit der Verabreichung von Hormonen zwar Einzelerfolge. Insgesamt ist dieses Gebiet aber zu wenig erforscht, um Empfehlungen abzugeben. Möglicherweise gibt es hierzu in einigen Jahren neue Erkenntnisse, weil auch Pharmakonzerne in dieses Forschungsgebiet investieren, z.B. um Medikamente gegen das Prämenstruelle Syndrom oder Wechseljahrbeschwerden zu entwickeln.
Chronobiologische Methoden
Ein teilweiser oder vollständiger Schlafentzug kann die Stimmung bei einer Depression verbessern – er darf aber nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen! Nicht alle Frauen sprechen gleich gut darauf an, und der Effekt hält in der Regel nur wenige Tage an.
Die Lichttherapie wird ab und zu unterstützend bei postnataler Depression eingesetzt. Hierzu wird eine spezielle Lampe benötigt, der sich die Patientin täglich während einer gewissen Zeit aussetzt. Lichttherapie wird vor allem bei saisonal abhängiger Depression eingesetzt, aber auch bei postnataler Depression konnte in Einzelfällen eine Verbesserung der Symptome nachgewiesen werden.
Weitere alternative Therapieformen
Es gibt eine Reihe alternativer Behandlungsformen, die bei der Behandlung einer Depression unterstützend wirken können, wie z.B. Kinesiologie, Homöopathie, Akupunktur, Shiatsu, Cranio-Sacral-Therapie, Reiki, Ayurveda, Atemtherapie, Bach-Blüten-Therapie, und Therapien mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Bei einer leichten Depression können sie möglicherweise als alleinige Therapieform eingesetzt werden. Bei mittleren und schweren Depressionen raten wir jedoch, nicht auf Psychotherapie und allenfalls Medikamente zu verzichten.
Stationäre Behandlung
Leidet die betroffene Mutter an einer schweren Depression, muss sie stationär behandelt werden. Wenn immer möglich sollte sie in eine Klinik oder Psychotherapiestation eintreten, die über Mutter-Kind-Plätze verfügt. Leider gibt es schweizweit nach wie vor viel zu wenig Therapieplätze für Mütter mit kleinen Kindern.
Da es für die Plätze Wartelisten gibt, sollte man die Entscheidung zu einer stationären Behandlung nicht zu lange hinausschieben. Wenn eine Mutter notfallmässig eingeliefert werden muss, stehen die Chancen schlecht, dass sie einen Platz bekommt, wo sie ihr Kind mitnehmen kann. Die Behandlung wird dann langwieriger; nicht nur, weil die Mutter völlig am Ende ihrer Kräfte ist, sondern weil die Trennung vom Kind ihre Schuld- und Entfremdungsgefühle zusätzlich verstärkt. In spezialisierten Mutter-Kind-Stationen gibt es dagegen in der Regel Therapieprogramme, die speziell die Mutter-Kind-Beziehung fördern.
Gruppentherapie
An verschiedenen Orten in der Schweiz werden Gruppentherapien für Frauen durchgeführt, die unter postnataler Depression leiden. Das Konzept dazu stammt von einem Team an der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Basel. Es wurde auf Basis verschiedener Ansätze aus dem englischsprachigen Raum entworfen und in jahrelanger Praxis weiterentwickelt. Der Vorteil einer Gruppentherapie ist neben den geringeren Kosten auch der Erfahrungsaustausch zwischen den betroffenen Frauen und die Erkenntnis, dass andere mit den gleichen Fragen und Schwierigkeiten kämpfen. Die Gruppentherapie besteht in der Regel aus 12 Sitzungen à 90 Minuten, die wöchentlich stattfinden.
Gruppen- und Einzeltherapie schliessen sich nicht gegenseitig aus. Sie können einander sinnvoll ergänzen.





 Facebook
Facebook Instagram
Instagram