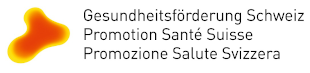News
-
Mittwoch, 14. Januar 2026
Ihre Erfahrungen werden gesucht
BFH startet Studie zu Angststörungen & Depressionen rund um die Mutterschaft
Paarprobleme
Eine Geburt verändert die Paarbeziehung nachhaltig. Die Rollen werden neu verteilt, die Eltern haben weniger Zeit füreinander, die Mutter vielleicht keine Lust auf Sex, der Vater fühlt sich durch die enge Bindung zwischen Mutter und Kind manchmal ausgeschlossen – er kann sich bereits während der Schwangerschaft von der Mutter-Kind-Beziehung verdrängt fühlen. Die Hauptlast der beruflichen Veränderung durch ein Kind wird nach wie vor meistens von der Frau getragen, die in ihrer Karriere zurückstecken muss.
Möglicherweise arbeitet der Mann gleichzeitig mehr oder fängt eine zusätzliche Ausbildung an, aus Angst, seiner Ernährerrolle nicht gerecht werden zu können; und vernachlässigt dabei seine Familie. Bei einer traditionellen Rollenaufteilung driften die Interessen der Ehepartner auseinander und es ist nicht immer einfach, sich in den Alltag des anderen mit seinen Schwierigkeiten einzufühlen.
Vorher bereits bestehende Konflikte werden durch die Ankunft eines Kindes in der Regel verstärkt. Die Zeit nach der Geburt ist sehr anfällig für Paarkrisen, die wiederum eine Depression begünstigen können – allerdings auch umgekehrt.
Hormone
Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Hormonen, körperlichen und psychischen Veränderungen und äusseren Einflüssen ist sehr komplex und noch nicht vollständig erforscht. Die gewaltigen Hormonveränderungen während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit scheinen jedoch psychische Störungen zu begünstigen.
- Geschlechtshormone: Während der Schwangerschaft ist die Menge von Östrogen etwa zweihundertmal höher als normal. Der Progesteronwert ist fünfzig- bis hundertfach erhöht. Nach der Geburt sinken sie innerhalb weniger Tage auf die ursprünglichen Werte ab. Manche Frauen reagieren empfindlicher auf solche Veränderungen. Das zeigt sich manchmal schon vor der Schwangerschaft als prämenstruelles Syndrom, oder als ausgeprägte Hochstimmung während der Schwangerschaft. Eine Sterilisation direkt nach der Geburt kann eine Postpartale/Postnatale Depression ebenfalls begünstigen, weil die Eierstöcke danach weniger Progesteron bilden.
- Immer dann, wenn eine hormonelle Umstellung stattfindet im Körper, ist eine Frau besonders anfällig für eine Depression. Solche Zeitpunkte sind die Zeit kurz nach der Geburt, das Wiedereinsetzen der Menstruation, die Wiedereinnahme der Pille und das Abstillen. Aber auch andere Hormone, z.B. Stresshormone, haben einen wesentlichen Einfluss auf das psychische Befinden.
- Es gibt Wechselwirkungen zwischen den weiblichen Hormonen und den Neurotransmittern, die die Stimmung regulieren (z.B. Serotonin, Noradrenalin, Dopamin). Diese Wechselwirkungen sind noch nicht genügend erforscht.
- Hormone rund um die Geburt: Eingriffe in den Geburtsprozess mittels PDA, Medikamenten, künstlichen Hormonen oder Kaiserschnitt können den „Hormoncocktail“ stören, der nach der Geburt dafür sorgen soll, dass die Mutter eine Bindung zu ihrem Kind entwickelt. Das erwartete Hochgefühl nach der Geburt bleibt aus, und die frischgebackene Mutter ist frustriert.
- Stresshormone: Das körpereigene System, das für die Hormonausschüttung bei Stresssituationen zuständig ist, reagiert vom letzten Drittel der Schwangerschaft bis ein paar Wochen nach der Geburt verzögert. Wird das System in dieser Zeit mit zu vielen Stresssignalen bombardiert, wird es überreizt und reagiert unkontrolliert, was das vegetative Nervensystem beeinträchtigt. Mögliche Folgen sind Herzrasen, Schweissausbrüche, Angstattacken und zitternde Hände.
- Schilddrüse: Manchmal kann es nach der Geburt zu einer Schilddrüsenfehlfunktion kommen, wodurch das vegetative Nervensystem durcheinander gerät. Eine Überfunktion kann zu Herzrasen, Nervosität, Reizbarkeit, Überängstlichkeit und Schlafproblemen führen. Eine Unterfunktion dagegen bewirkt stumpfe Haut, Haarausfall, Lethargie und Verlust der Lebensfreude.
Psychische Ursachen
Die Geburt eines Kindes ist ein Wendepunkt im Leben. Vieles ändert sich sehr plötzlich, und die Eltern, insbesondere die Mutter, müssen eine enorme Anpassungsleistung erbringen. An solchen Wendepunkten sind wir für Krisen besonders anfällig.
Identitätskrise
Die Geburt eines Kindes, insbesondere des ersten, bringt eine Reihe von Rollen- und Beziehungsänderungen mit sich: Eine Tochter wird zur Mutter, eine berufstätige Frau vielleicht zur Hausfrau, kinderlose Freundinnen ziehen sich zurück. Die eigene Identität und die Beziehungen zum Umfeld müssen neu definiert werden. Empfindet eine Frau die neue Konstellation als unbefriedigend, kann es zu einer Identitätskrise kommen.
Abschied und Neubeginn
Die Geburt eines Kindes ist mit einer Reihe von Abschieden und Verlusten verbunden: Abschied von der eigenen Kindheit, von der Schwangerschaft und der damit verbundenen Aufmerksamkeit, von Fantasien im Bezug auf das Kind, von einem idealisierten Mutterbild, eventuell vom Beruf, von der Freiheit, über die eigene Zeit zu verfügen. Gefühle der Trauer sind daher normal. Wird die Trauer als „abnormal“ verdrängt und beiseite geschoben, kann sie sich zu einem späteren Zeitpunkt als Depression zurückmelden. Gelingt dagegen der Abschied vom alten Leben, kann die neue Situation auch als positiv erlebt werden und Kraft daraus geschöpft werden.
Neudefinition von Beziehungen
Nicht nur die bisherigen Beziehungen innerhalb der eigenen Familie verändern sich mit der Ankunft eines Kindes, sondern sämtliche Beziehungen überhaupt. Beispielsweise verändert sich das Verhältnis zur eigenen Mutter, eigene frühkindliche Emotionen und Bedürfnisse kommen hoch. Möglicherweise reagieren kinderlose Freundinnen und Freunde, die zwangsläufig einen anderen Lebensstil haben, mit Unverständnis auf die neue Situation und wenden sich ab.
Belastende seelische Erfahrungen
Unverarbeitete seelische Belastungen aus der Vergangenheit können durch die Grenzerfahrung des Mutterwerdens hochgespült, alte Wunden aufgerissen werden. Solche unverarbeiteten Erlebnisse können der Tod einer nahestehenden Person sein, frühere psychische Erkrankungen, sexueller Missbrauch, zerrüttete Familienverhältnisse, Umzug, Jobverlust, Abtreibung, Fehlgeburt, Verunsicherung durch vorgeburtliche Untersuchungen usw. Insbesondere erhöhen negative Erlebnisse, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt des Kindes eingetreten sind, das Risiko für eine Postpartale/Postnatale Depression.
Selbstaufopferung
Manche Frauen bemühen sich so sehr darum, einem idealisierten Mutterbild zu entsprechen, dass sie sich darüber selbst vergessen. Sie schlafen zu wenig, vernachlässigen die eigenen Bedürfnisse vollständig und gestehen sich keine Erholung zu. Wer immer nur gibt und nie Energie auftankt, wird zwangsläufig irgendwann zusammenbrechen.
Schuldgefühle
Erreicht eine Frau trotz Aufbietung aller Kräfte ihr idealisiertes Mutterbild nicht, wird sie permanent das Gefühl von Unzulänglichkeit haben und sich schuldig fühlen bis hin zur Selbstverachtung.
Kontrollbedürfnis
Frauen, die dazu neigen, alles unter Kontrolle haben zu wollen, haben eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Postpartaler/Postnataler Depression.
Perfektionismus
Ein ausgeprägter Perfektionismus, kombiniert mit einer hohen Erwartungshaltung, kann sich zu einer Falle aus Versagensgefühlen entwickeln.
Neigung zu extremer Besorgnis
Die Neigung zu extremer Besorgnis kann die Kinderpflege in einen dauerhaften Stresszustand verwandeln und damit das Entstehen einer Postpartalen/Postnatalen Depression begünstigen.
Körperliche Ursachen
Genetische Veranlagung
Frauen mit einer genetischen Veranlagung zu psychischen Erkrankungen, vor allem mit einer durchgemachten Depression, sind stärker gefährdet. Man geht heute davon aus, dass 40-50% von Depressionen genetisch mitverursacht sind. Die genetische Veranlagung kann sich an einer früheren Postpartalen/Postnatalen Depression oder sonstigen psychischen Erkrankung bei der Frau oder einer blutsverwandten Person zeigen.
Gestörter Schlaf
Ein immer wieder gestörter Schlaf führt nicht nur zu massiver Erschöpfung, sondern auch zu biochemischen Veränderungen im Körper: Die Stoffwechselprozesse und die Tätigkeit der Drüsen sind beeinträchtigt. Folgen eines massiv gestörten Schlafs können Verwirrung, Wutanfälle, Angstattacken und Halluzinationen sein.
Körperliche Veränderungen durch die Geburt
Nach der Geburt bildet sich der weibliche Körper erst allmählich zurück. Oft bleibt das Gewicht über demjenigen, das die Frau vor der Schwangerschaft hatte. Auch Dehnungsstreifen und Krampfadern können zunächst als sichtbare Zeichen der Mutterschaft zurückbleiben. Das macht manchen Frauen zu schaffen. Dazu können verschiedene Beschwerden kommen wie Verstopfung und Schmerzen an der Damm- oder Kaiserschnittnaht oder in den Brüsten.
Hormone
Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Hormonen, körperlichen und psychischen Veränderungen und äusseren Einflüssen ist sehr komplex und noch nicht vollständig erforscht. Die gewaltigen Hormonveränderungen während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit scheinen jedoch psychische Störungen zu begünstigen.
Mangelerscheinungen
Körperliche Mangelerscheinungen können ebenfalls Depressionen auslösen, z.B. ein starker Blutverlust bei der Geburt oder Vitamin- oder Mineralstoffmangel durch einseitige Ernährung.
Blutzuckerschwankungen
In den ersten Wochen nach der Geburt, wenn sich noch kein fester Tagesablauf eingespielt hat, besteht die Gefahr, dass die Mutter nicht regelmässig isst bzw. sich falsch ernährt. In der Wochenbettzeit sinkt der Blutzuckerspiegel etwa drei Stunden nach der letzten Mahlzeit ab (sonst in etwa 4-5 Stunden). Wird dann nicht etwas Kohlenhydrathaltiges gegessen, kommt es zu einer Ausschüttung von Adrenalin, was verschiedene Symptome der Postpartalen/Postnatalen Depression verstärken kann: Erregtheit, Reizbarkeit, Panik, Rückzug und Erschöpfung.
Ursachen rund um die Geburt
Schwangerschaft
Schwierigkeiten rund um die Schwangerschaft können eine Depression begünstigen, z.B. eine lange erwartete oder eine ungewollte Schwangerschaft, eine Depression während der Schwangerschaft oder körperliche Komplikationen bei der Schwangeren oder beim ungeborenen Kind.
Traumatische Geburt
Notfallkaiserschnitt können ebenfalls eine Postpartale/Postnatale Depression auslösen. Entscheidend ist nicht die objektive Schwere einer Geburt, sondern das subjektive Empfinden der Frau während der Geburt. Schädlich ist insbesondere das Gefühl von Kontrollverlust und Ausgeliefertsein. Dieses Gefühl kann sich auch bei einer sehr schnellen Geburt einstellen, von der sich die Mutter emotional überrumpelt fühlt. Dass ihr Umfeld eine so „leichte“ Geburt als Glücksfall preist, kommt erschwerend hinzu.
Oft muss sich die Mutter von ihrem eigenen Wunschbild einer Traumgeburt verabschieden, die gemäss gängigem Muttermythos schön und überwältigend zu sein hat. Hier können bereits erste Schuld- und Versagensgefühle auftreten.
Probleme im Wochenbett
Diverse körperliche Probleme im Wochenbett (Infektion, schwere Anämie oder ein ausgeprägtes postpartales Stimmungstief), Gesundheitsprobleme beim Kind (Frühgeburt, Krankheit, Behinderung) oder eine verzögerte Entwicklung, Schreibabys und Stillprobleme (Brustentzündung, Ansetzschwierigkeiten, zu wenig Milch) erhöhen das Risiko einer Postpartalen/Postnatalen Depression.
Abstillen / Abstillmedikamente
Beim Abstillen, insbesondere wenn es abrupt geschieht, kommt es zu einem Abfall der stimmungsaufhellenden Endorphine im Körper. Dadurch kann eine Depression ausgelöst werden. Wenn das Abstillen gegen den Willen der Mutter geschieht, können Versagensgefühle hinzukommen. Wurde die Stillzeit als glücklich erlebt, ist das Abstillen auch eine Verlusterfahrung. Ausserdem stehen gewisse Abstillmedikamente im Verdacht, Depressionen auszulösen.





 Facebook
Facebook Instagram
Instagram