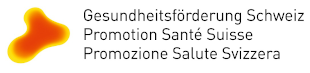Interview mit Alessandra Weber

Frau Weber, bei unserem Verein melden sich Mütter und Väter, die in den ersten Wochen oder auch Monaten nach der Geburt ihrer Kinder in einer seelische Krise rutschen, eine Postpartale Depression erleiden. Ihre Kinder sind also meist noch sehr klein, werden zum Teil noch gestillt und können noch nicht verstehen, warum es Mami oder Papi gerade so schlecht geht. Häufig sind Betroffene von starken Schuldgefühlen geplagt und haben grosse Angst, dass Kind könnte langfristig unter der Situation leiden und Schaden nehmen.
Spüren Babys oder Kleinkinder, wenn es ihren Eltern mental nicht gut geht? Auch wenn sie versuchen die negativen Gefühle und Gedanken so gut es geht zu verstecken?
Babys und Kleinkinder lernen vor allem, indem sie ihre Umgebung ganz genau beobachten. Als soziales Wesen achten sie auch vom ersten Tag an ganz aufmerksam auf ihre nächsten Bezugspersonen. Wie kleine Seismographen scannen sie deren Mimik, Gestik, Körperhaltung und Stimme. So spüren sie auch die Stimmungen ihrer Eltern. Darum: ja, auch ganz kleine Kinder kriegen es mit, wenn es ihren Eltern nicht gut geht.
Welchen Einfluss in Bezug auf die psychische aber auch die physische Entwicklung eines Kindes kann eine Postpartale Depression eines Elternteils kurzfristig, aber auch im späteren Leben der Kinder, haben?
Wichtig scheint mir vorab: auch psychisch belastete Mütter und Väter, sind gute Eltern und wollen für ihr Kind das Beste. Doch durch eine Erkrankung werden die Bedürfnisse des Kindes unter Umständen nicht genügend befriedigt. Je nachdem, wie stark dies der Fall ist und wie lange dieser Zustand andauert, kann das Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten beim Kind steigt. Es kann auch einen Einfluss auf die Beziehungen des Kindes zu anderen Menschen haben, da es möglicherweise keine sichere Bindung zu den Eltern aufbauen kann. Und das Risiko, dass das Kind später selber einmal an einer Depression leidet, nimmt zu.
Was empfehlen Sie Eltern, die bereits schon ältere Geschwisterkinder haben, wie sie die Erkrankung kindgerecht erklären sollten? Worauf sollten Eltern achten und was eher vermeiden, damit sich das Kind nicht fälschlicherweise als Ursache der schwierigen Situation sieht?
Ich empfehle den Eltern, ihre Erkrankung nicht nur älteren Geschwistern gegenüber zum Thema zu machen, sondern das auch dem Baby gegenüber auszusprechen. Das mag jetzt befremdend klingen, da das Baby ja nie und nimmer die Worte versteht. Doch – wie gesagt – Babys sind Seismographen, sie erspüren die Stimmungen ihrer Eltern. Und wenn eine erkrankte Mutter ihr Baby fest in den Arm nimmt und ihre Krankheit anspricht, dann nimmt es ihre Botschaft auf – nicht kognitiv, gefühlsmässig. Sie kann in etwa zu ihm sagten: „Mir geht es nicht gut und ich glaube du merkst das. Es tut mir so leid, dass das so ist. Mit dir hat es nichts zu tun. Du bist wunderbar. Ich bin krank und ich werde alles dafür tun, dass das wieder besser wird. Doch es wird eine Weile dauern.“
Sowas können die Eltern auch zu älteren Geschwistern sagen und – je nach Alter – auch noch etwas mehr über die Krankheit erzählen. Zum Beispiel könnte das Mami erklären, dass es wegen der Krankheit ist, dass sie am Morgen Mühe hat aufzustehen oder nicht mit dem Kind auf den Spielplatz gehen mag. Wichtig ist, dass die Eltern offen über die Krankheit reden und das Kind auch Fragen dazu stellen darf. Es gibt auch Bilderbücher über Depressionen, die sich gut dazu eignen dem Kind die Krankheit näher zu bringen und mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel „Mamas Monster“, „Warum ist Mama traurig?“ oder „Schoko- und Zitronentage“: Auf unserer Webseite haben wir eine Liste solcher Bücher zusammengestellt:
Kann auch später an der Bindung, welche möglicherweise zu Beginn zu kurz kam, gearbeitet werden? Was empfehlen Sie, um dies zu ermöglichen?
Eine engere Beziehung zum Kind können Eltern jederzeit aufbauen. Allerdings sind die ersten drei Lebensjahre für die Entwicklung des Bindungsverhaltens des Kindes entscheidend und darum ist es wichtig, dass sich Eltern möglichst bald Hilfe holen, wenn sie an einer postpartalen Depression leiden. Eine Hebamme, die die Familie daheim besucht, kann beispielsweise die betroffene Mutter oder den betroffenen Vater dazu ermuntern, die Signale des Kindes neugierig zu beobachten und auf diese zu reagieren - mit einem Lächeln, einer Berührung. Oder sie fördert den Körperkontakt zwischen Eltern und Kind, indem sie den Eltern zeigt, wie sie das Baby im Tragetuch herumtragen können. Auch später können Eltern sich darin anleiten lassen oder üben, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und darauf zu reagieren. Hier kann auch die Mütter- und Väterberatung helfen.
Welche Auffälligkeiten beim Kind sollten Eltern ernst nehmen, die unter einer psychischen Störung leiden?
Das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird, denn die meisten Erwachsenen nehmen an, dass Kinder auffällig werden, wenn sie etwas belastet. Es gibt allerdings bei betroffenen Kindern verschiedene Verarbeitungsmuster und das introvertierte Muster ist sogar häufiger wie das extrovertierte. Das bedeutet, dass es durchaus sein kann, dass ein Kind reagiert, indem es sogenannt auffällig wird und sich sehr rebellisch, trotzig bis aggressiv verhält und keinerlei Grenzen respektiert. Dieses Verhalten ist eigentlich ganz gesund, denn das Kind weist sein Umfeld damit explizit darauf hin, dass es ihm nicht gut geht. Das ist das Schöne an Babies: sie schreien, werden unruhig, wenn es für sie nicht mehr stimmt. Sie reagieren also noch extrovertiert und signalisieren dem Umfeld lauthals, dass sie etwas Anderes brauchen.
Viele ältere Kinder reagieren aber nicht mehr extrovertiert. Sie haben sich angewöhnt, sich enorm anzupassen, werden ganz unauffällig, wenn es in der Familie schwierig wird. Sie strengen sich an, alles möglichst gut zu machen, wollen Mami und Papi helfen. Diese Kinder werden dann oft von den Erwachsenen für ihr Verhalten gelobt, was die Überanpassung noch verstärkt. Schlussendlich brauchen all diese Kinder dasselbe, egal mit welchem Verhaltensmuster sie reagieren: Erwachsene, die verlässlich für sie da sind, die sich für ihre Bedürfnisse interessieren und dafür sorgen, dass diese auch bei einer momentan belastenden Familiensituation nicht zu kurz kommen.
Welche Unterstützungsmöglichkeiten für das Kind, aber auch für die betroffenen Eltern, gibt es?
Dem Kind geht es gut, wenn es den Eltern gut geht. Darum ist es sehr wichtig, dass sich die Erwachsenen Hilfe holen und dafür sorgen, dass es ihnen möglichst bald wieder besser geht. So kann die Hebamme beispielsweise nach Hause kommen und die betroffenen Eltern hilfreich unterstützen. Das darf sie bei Bedarf übrigens auch noch nach den offiziell von der Krankenkasse finanzierten ersten Wochen. Auch eine Psychotherapie ist sicher ratsam, allenfalls sogar eine Auszeit in einer Klinik. Es gibt gute Mutter-Kind-Stationen. Und Menschen aus dem sozialen Umfeld, die ganz pragmatische Entlastung im Alltag bieten, sind auch hilfreich – Hilfe beim Einkauf, bei der Kinderbetreuung, beim Erledigen des Haushalts. Wenn einer Familie ein solches soziales Netz fehlt, kann sie auch schauen, ob es an ihrem Wohnort entsprechende Entlastungsangebote gibt. Die Gemeindeverwaltung kann da bestimmt Auskunft geben.
Für das Kind oder die Kinder ist es wichtig, dass immer eine vertraute und verlässliche erwachsene Bezugsperson da ist, die auch nicht ständig wechselt. Und für ältere Geschwister ist es schön, wenn sie immer wieder Dinge tun können, die ihnen Freude machen: mit dem Grosi auf den Spielplatz oder beim Nachbarskind im Garten spielen.
Über das iks
Das iks setzt sich dafür ein, dass sich Kinder psychisch erkrankter Eltern gesund entwickeln. Sie beraten Betroffene, ihr soziales Umfeld und Fachpersonen und vermitteln Hilfe.
Webseite: https://www.kinderseele.ch/


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram