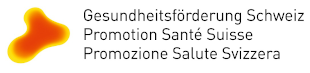Erfahrungsbericht von Francesca
«Ich wollte so gerne Mutter werden: Ich träumte davon, dass die Elternschaft eine Erfahrung von immenser Freude und Liebe sein würde»
Alles begann mit dem starken Wunsch, Mutter zu werden, der sich endlich an jenem Tag im November 2021 erfüllte, als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel. Ich erinnere mich, wie ich in meiner Mittagspause im Badezimmer zu Hause auf die dünne rosa Linie schaute und mich fragte: "Ist das wirklich wahr? Ich kann es nicht glauben". Ich habe gleichzeitig gelacht und geweint. Die gesamte Schwangerschaft war für mich eine Zeit des Glücks, in der ich davon träumte, dass das Muttersein eine Erfahrung von immenser Freude und Liebe sein würde.

Mein Name ist Francesca, ich habe zwei Brüder und wir sind Drillinge. Unsere leibliche Mutter hat sich 2 Monate nach unserer Geburt das Leben genommen und hatte angeblich eine postpartale Depression. Mein Vater hat später wieder geheiratet, und zum Glück hatten wir eine Mutterfigur, die uns aufzog.
«Ich dachte, ich hätte den Verlust meiner Mutter verkraftet, aber die Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt hatte.»
Seit meiner Jugend hatte ich immer Angst vor postpartalen Depressionen und Selbstmord, auch wenn ich hoffte, dass mir das nicht passieren würde. Seit meinem 16. Lebensjahr befinde ich mich tatsächlich in Psychotherapie: Ich dachte, ich hätte den Verlust meiner Mutter verarbeitet und mich endlich davon überzeugt, dass ich nicht so bin wie sie und dass jeder seine eigene Geschichte hat, aber die Dinge entwickelten sich nicht so, wie ich sie mir vorgestellt hatte.
Der Schwangerschaftstermin war Ende Juli. Ich war so glücklich, ich konnte es kaum erwarten, unser Kleines kennenzulernen. Alles war bereit, Kinderzimmer, Kleidung, Wickeltisch....
Die Tage vergingen und der Geburtstermin rückte näher, also ging ich ins Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen, und man sagte mir, dass es immer noch keine Wehen gäbe und ich nach 2 Tagen wiederkommen solle. Als ich zurückkam, war immer noch nichts zu sehen. Sie schlugen eine Einleitung vor, und zusammen mit meinem Mann stimmten wir zu. Es war ein Donnerstagmorgen, wir kamen im Krankenhaus an und sie begannen mit der Einleitung. Keine Wehen bis Freitagabend. Am Freitagabend brach die Fruchtblase und von da an begannen die starken Schmerzen. In der Nacht zum Donnerstag hatte ich sehr wenig geschlafen, war also sehr müde und konnte die Schmerzen nicht ertragen, also habe ich eine Periduralanästhesie beantragt (Samstagmorgen gegen 3 Uhr). Ich ging hinunter in den Kreisssaal und Mattia wurde am Samstag, den 6. August 2022, um 14.14 Uhr geboren.
Als sie ihn mir auf die Brust legten, empfand ich grosse Freude, ich weiss noch, dass ich ihn überall küsste und mich sehr wohl fühlte. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das sei der schönste Moment meines Lebens. Dann hatte Mattia leider ein Atemproblem und ich konnte ihn nicht wie üblich Haut an Haut halten. Zum Glück löste sich das Atemproblem schnell und wir konnten auf das Zimmer gehen. Das Stillen verlief von Beginn an reibungslos.
Dann erinnere ich mich, dass ich aufstand, um auf die Toilette zu gehen, und in Ohnmacht fiel, weil ich viel Blut sah, und ich weiss noch, dass ich sagte: "Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben": Ich begann Angst zu haben, so zu enden wie meine Mutter.
«Alles musste perfekt und unter Kontrolle sein.»
In der ersten Nacht im Krankenhaus habe ich nicht geschlafen, auch nicht in der zweiten oder dritten Nacht: Ich erinnere mich, dass ich während meines gesamten Aufenthalts im Krankenhaus nicht einschlafen konnte. Ich war immer in Sorge um das Baby, beobachtete, ob es atmete, kontrollierte alles: Alles musste perfekt und unter Kontrolle sein.
Das Wohlgefühl nach der Geburt liess nach und die Hormone fielen abrupt ab. Ich begann mich niedergeschlagen und unglücklich zu fühlen. Ich sagte mir immer wieder: "Ich habe Angst, wie meine Mutter zu werden", "Ich habe Angst, Depressionen zu bekommen", und das sagte ich auch den Hebammen.
Als ich eines Abends aus dem Fenster im 4. Stock schaute, bekam ich Angst, weil ich dachte, wenn Mattia und ich von dort herunterfallen würden, würden wir sterben. Ich sprach mit der Hebamme darüber und sie schloss das Fenster für mich.
Ich wechselte von Momenten extremer Müdigkeit (ich konnte nicht schlafen) zu Momenten der Hyperaktivität, in denen ich mich aufgeladen und voller Energie fühlte.
Die Ärzte beschlossen, mich zu entlassen, und ich war überglücklich, nach Hause zu gehen, war aber sehr müde und fühlte mich seltsam, wie in einer Blase. Als ich das Krankenhaus verliess, hatte ich das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Ich sprach sofort mit meiner Psychologin und erzählte ihr von meiner Angst, eine postpartale Depression zu bekommen: Ich musste so dringend schlafen, aber ich konnte nicht, ich war besessen von der Angst, so zu enden wie meine Mutter.
Das Haus wurde allmählich immer unordentlicher, die Wäschekörbe quollen über, und ich kam nicht mehr zurecht. Auch wenn mir die Unordnung egal war, ich dachte nur an mein Baby und das Stillen. Ich erinnere mich, dass ich meine Tage im Bett verbrachte, um zu stillen und ab und zu aufstand, um zu essen. Dann erinnere ich mich, wie ich meinem Mann befahl, was er zu tun hatte, und wie ich mir alles aufschreiben musste, weil ich kein Gedächtnis hatte. Am Ende war ich so erschöpft, dass ich im Bett ass, literweise Wasser trank und so sehr schwitzte. Ich betrachtete mich im Spiegel und erkannte mich nicht mehr. Mein Körper, der neun Monate lang rund und geschwollen gewesen war, hatte sich auf einmal entleert. Es war so seltsam...
Die Hebamme meines Vertrauens war im Urlaub, als ich entband, aber ich hörte immer wieder von ihr am Telefon. Ich fragte sie immer wieder, ob mein Verhalten normal sei, weil ich das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Niemand erkannte den Ernst der Lage, man sagte mir nur, dass ich schlafen müsse. Die Hebamme sagte mir, dass ich die Phase des Babyblues durchmachte.
«Niemand erkannte den Ernst der Lage, man sagte mir nur, dass ich schlafen müsse.»
Zehn Tage nach der Geburt war ich im Delirium. Ich erinnere mich, dass ich anfing, mich mit Essen und Wasser vollzustopfen (ich trank fast 10 Liter), ich habe gegessen wie ein Tier. An dem Tag, an dem das Schlimmste passierte, begann ich, unwirkliche Vorstellungen zu haben: Ich verstand nicht mehr, was Realität ist. Ich war überzeugt, dass ich einen Blutsturz haben würde und dass mein Vater sterben würde (ich hörte sogar die Glocken seiner "Beerdigung"), ich wollte nicht, dass mein Mann mich verlässt, weil ich mich verlassen fühlte, und ich war überzeugt, dass meine leibliche Mutter Selbstmord begangen hatte, weil mein Vater sie verlassen hatte.
Während der Krisenphase telefonierte ich mit meiner Hebamme und meinem Psychologen, um mich zu beruhigen. Endlich kam mein Bruder und holte mich ab und brachte mich, meinen Sohn und meinen Mann auf die Entbindungsstation des Krankenhauses. Ich habe sie im wahrsten Sinne des Wortes in Panik versetzt. Ich erinnere mich, dass mein Mann sich kurz von mir entfernte, um Wasser zu holen, und ich sagte zu ihm: "Du hast mich verlassen, ich habe dir gesagt, du sollst mich nie verlassen"; dann begann ich, alles um mich herum weiss zu sehen, ich kam aus diesem Albtraum nicht mehr heraus, ich hörte die Stimmen der Hebammen, die auf unnatürliche Weise mit mir sprachen, und alles wiederholte sich immer wieder. Ich dachte, ich sei tot, ich erinnere mich, dass ich sehr laut schrie und mich selbst ohrfeigte, weil ich aus diesem Alptraum aufwachen wollte, aber ich konnte nicht. Endlich gab ich auf und sagte mir: "Dann ist das der Tod", und ich liess mich in die Arme von ich weiss nicht wem fallen.
Dann "wachte" ich aus diesem Albtraum im Krankenhausbett auf, sah meinen Mann neben mir und sagte ihm: "Ich habe schlecht geträumt", und er sagte mir, dass es kein Traum war, sondern dass alles wirklich passiert war. Ich fragte ihn sofort, ob es auch stimme, dass mein Vater gestorben sei, und er sagte "nein". Ein Psychiater, der Pikettdienst hatte, erschien dann am Morgen und erklärte mir, dass ich eine psychotische Episode gehabt hätte und schlug vor, mich in die psychiatrische Klinik in Orselina einzuweisen. Ich sagte zu.
«Ich fühlte mich losgelöst von der Welt. Alles schien mir fremd zu sein»
Zuerst kam ich in ein Gemeinschaftszimmer, aber ich fühlte mich nicht wohl und hatte Todesgedanken, also beschlossen sie mit meinem Einverständnis, mich eine Woche lang in die geschützte Abteilung zu verlegen. Ich fühlte mich von der Welt abgeschnitten. Alles um mich herum erschien mir fremd. Ich sah die Krankenschwestern und sie schienen sich seltsam zu verhalten, aber ich war es, die die Realität nicht wahrnehmen konnte. Während meines Aufenthalts auf der geschützten Station konnte ich meinen Sohn nicht sehen. Darunter habe ich sehr gelitten. Dann musste ich mit dem Stillen aufhören, weil nicht bekannt war, ob die Medikamente, die ich nahm, verträglich waren. Die Ärzte begannen, mich mit Olanzapin zu behandeln, und allmählich ging es mir besser und ich fand wieder Anschluss an die Realität.
Nach einer Woche auf der geschützten Station wurde ich auf die allgemeine Station verlegt, zunächst in ein Doppelzimmer, dann in ein Einzelzimmer. Endlich konnte ich meinen Sohn wiedersehen. Ich erinnere mich an diesen Moment als sehr emotional.
Nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt (Ende August) konnte ich nach Hause gehen, obwohl mir geraten worden war, noch eine Woche zu bleiben, weil man vermutete, dass ich unter einer postpartalen Depression leiden könnte. Aber ich wollte nicht bleiben. Ich kehrte mit meinem Mann und meinem Sohn nach Hause zurück.
Wir merkten bald, dass wir Hilfe brauchen würden, und so zogen wir für eine Weile zu meinen Eltern. Meine Mutter half mir mit dem Baby. Sie liess mich nachts schlafen und wachte auf, um ihn zu füttern.
Die Aufnahme in die Klinik hat meinen Schlaf-Wach-Rhythmus und meinen Essensrhythmus wiederhergestellt, die zuvor aus dem Takt geraten waren.
Nach ein paar Monaten bei meinen Eltern zogen wir zurück in unser Haus, und es schien ganz gut zu laufen, obwohl ich mich nie wirklich gut fühlte. Ich habe immer gesagt, dass ich mich nicht mehr wie ich selbst fühle. Und ich war immer ein bisschen traurig und apathisch.
«Ich bekam solche Angst, weil ich meine Gedanken nicht mehr kontrollieren konnte.»
Eines Abends im Dezember, als ich Mattia sein Fläschchen gab, schoss mir ein hässlicher Gedanke durch den Kopf. Ich bekam solche Angst, dass ich meine Gedanken nicht mehr kontrollieren konnte. Ich rief sofort den Pfleger an, der mich begleitete, um ihm davon zu erzählen. Ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen. In den nächsten Wochen ging es mir immer schlechter. Die Gedanken wurden zwanghaft und ich konnte sie nicht mehr kontrollieren, so dass ich Angst hatte, meine Gedanken würden real werden. Ich konnte nicht mehr mit meinem Sohn allein sein. Ich hatte wirklich Angst. Ich spürte immer einen Druck auf meiner Brust.
Als mir wirklich klar wurde, dass ich so nicht weitermachen konnte, beschloss ich, in Begleitung meines Bruders in die Notaufnahme zu gehen. Ich wurde von einem Psychiater untersucht, der mich mit der Diagnose "nicht näher bezeichnete Angstzustände" entlassen hat.
Meine Psychiaterin war im Urlaub, aber sie erhöhte telefonisch die Dosis der Medikamente, die ich einnahm. Die Situation besserte sich nicht. Einige Tage später beschloss ich, mich erneut in die Notaufnahme zu begeben, wo ich dieses Mal um eine Einweisung bat. Und von diesem Tag an verbrachte ich 3 Monate in der Klinik Santa Croce in Orselina. Es waren die traurigsten und dunkelsten 3 Monate meines Lebens.
Zum Glück hatte ich ein Einzelzimmer, so dass ich meinen Mann und meinen Sohn regelmässig sehen konnte (sie brachten ihn etwa zweimal pro Woche für eine Stunde zu mir).
Ich fühlte mich niedergeschlagen, dumpf, ängstlich und machte mir Sorgen, dass ich nie wieder so sein würde wie früher. Ich war einmal eine normale Frau, sagte ich mir. Ich habe mich oft gefragt, wie mir das passieren konnte. Auch wenn ich weit weg von meinem Sohn war, hatte ich immer noch zwanghafte Gedanken über ihn, und ich fühlte mich sehr schlecht dabei.
Die Ärzte begannen auch, mich mit Temesta zu behandeln, um mich zu beruhigen, aber das hat nicht geholfen. Dann begannen sie, meine medikamentöse Therapie zu ändern, ohne dass dies etwas brachte. Nach etwa einem Monat fügten sie einen Stimmungsstabilisator hinzu (sie vermuteten, dass ich bipolar sein könnte), der mich sehr müde machte und meiner Meinung nach meiner Stimmung nicht zuträglich war. Ein Monat vor dem Ende meines Krankenhausaufenthalts wurde endlich ein Antidepressivum (Anafranil) verschrieben. Von da an ging es mir jeden Tag besser: Die Zwangsgedanken verschwanden allmählich, und ich konnte wieder die Freude sehen, die ich monatelang nicht empfunden hatte.
Langsam konnte ich das Licht sehen.
Nach einem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt kehrte ich nach Hause zu meinem Sohn und meinem Mann zurück, aber wir blieben noch vier Monate bei meinen Eltern, die mich unterstützten und mir nahe standen. Im August zogen mein Mann, mein Sohn und ich in eine neue Wohnung im selben Dorf wie meine Eltern. Wir fingen endlich an, unsere Familie wieder aufzubauen, unser Nest.
«Jetzt fühle ich mich innerlich verändert. Ich fühle mich stärker. Ich habe mich selbst wiedergefunden.»
Ich hatte in diesen Monaten wirklich zu kämpfen, machte sehr schlechte Zeiten durch und dachte, ich würde es nicht schaffen: Jetzt kann ich endlich sagen, dass ich es geschafft habe. Ich habe es aus eigener Kraft geschafft, mit Hilfe der Therapie und der Therapeuten, die mich begleitet haben und immer noch begleiten, aber auch mit der Unterstützung meines Mannes, meiner Familie, meiner Freunde und von Postpartale Depression Schweiz. Ich hatte den Kontakt zu dieser Organisation dank einer Freundin aufgenommen, die mir den Link zur Website weiterleitete. Im Dezember, als es mir sehr schlecht ging, rief ich bei der Organisation an und konnte mit Elena sprechen. Ich habe ihr mein Unbehagen geschildert und sie hat mir sehr professionell zugehört. Sie hat mich herzlich aufgenommen. Sie gab mir das Gefühl, nicht allein zu sein. Sie vermittelte mir verschiedene Hilfsmöglichkeiten und stellte mir auch eine Patin vor, mit der ich heute noch in Kontakt bin. Die Patin hat mir auch sehr geholfen, mich nicht allein zu fühlen.
Ich bin Postpartale Depression Schweiz dankbar, denn die Organisation war und ist zusammen mit den anderen Fachleuten Teil meines Unterstützungsnetzwerks und hat mich auf meinem Weg zur Genesung begleitet.
Jetzt kann ich endlich mein Baby geniessen. Ich kann wieder mit ihm allein sein. Wir lernen uns von Tag zu Tag besser kennen. Wir gehen zusammen spazieren, fahren mit dem Fahrrad, spielen zusammen, lesen viele Bücher und treffen uns oft mit anderen Müttern und Kindern.
Ich hoffe, dass meine Geschichte denjenigen helfen kann, die in der Zeit nach der Geburt eine schwierige Zeit durchmachen. Habt keine Angst, über eure Gedanken zu sprechen, SPRICHT ÜBER SIE! Fragt nach Hilfe! Wir sind nicht allein, es gibt ein riesiges Netzwerk da draussen, das bereit ist, uns zu helfen!


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram