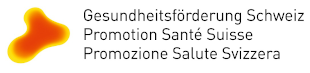Erfahrungsbericht von Aline
Seit ich 2018 endlich die Diagnose Endometriose bekommen habe, hatte ich Angst, nicht schwanger werden zu können. Alle – inklusive meiner Gynäkologin – sagten mir, dass es extrem schwierig werden würde.
2021 haben mein Partner und ich uns dann entschieden, es zu versuchen – und ich wurde tatsächlich im ersten Monat schwanger. Wir freuten uns riesig, und ich bereitete liebevoll das Kinderzimmer vor. Mir ging es grossartig: keine Morgenübelkeit, ich war sportlich aktiv und fühlte mich wohl in meiner Haut. Ich arbeitete 80 % und absolvierte nebenher meine zweite Ausbildung.
Der Geburtstermin war im November, und ich war bestens vorbereitet – mit Hypnobirthing, Musik, Ölen – ich freute mich auf die Geburt. Am 19. Oktober um 6 Uhr morgens hatte ich dann einen frühzeitigen Blasensprung (ich war zwei Wochen zuvor krankgeschrieben worden, um mich zu schonen, aber es gab keine Anzeichen für eine Frühgeburt!). Wir verbrachten den ganzen Tag in Spital Nr. 1 und später in Spital Nr. 2, wo dann ein Notkaiserschnitt bei 34+5 durchgeführt wurde. Unsere Tochter kam gesund zur Welt – und im ersten Moment verspürte ich nur Glück, Liebe und Dankbarkeit.
Dann kam der Schock: Die Kleine musste wegen einer Unterzuckerung auf die Neonatologie, mein Partner wurde aufgrund der Coronamassnahmen um 4 Uhr morgens nach Hause geschickt, und ich lag mutterseelenallein im Zimmer. Ich zitterte am ganzen Körper – ich war gerade fünf Wochen zu früh Mutter geworden, und dann war ich völlig allein. Die Krankenschwester kam und sagte, ich müsse jetzt abpumpen – was ich brav tat. Zwei Stunden später war ich bereits bei meiner Tochter, nur am Weinen, weil alles schmerzte und ich sie kaum halten konnte. So fing alles an.
Ich fühlte mich allein, überfordert, traurig und nicht adäquat begleitet. Ich weinte viel und hätte so sehr meinen Mann gebraucht – aber er durfte wegen der Massnahmen in Spital Nr. 2 nicht bei mir sein (in Spital Nr. 1 galten diese übrigens nicht …). Ich konnte nicht mehr schlafen, und es kamen wirre, negative Gedanken. Ich entwickelte aggressive Zwangsgedanken gegen mich selbst. Ich wollte nach Hause, ich wollte einfach diesen „perfekten“ Start. Ich war völlig erschöpft – von der Neo, vom Abpumpen, von der Sorge um meine Tochter.
Ich dachte: Zu Hause wird alles besser …
Doch zu Hause wurde es schlimmer. Die Zwangsgedanken weiteten sich auf meine Liebsten aus, und ich bekam Angst, allein oder mit meiner Tochter zu sein. Ich zweifelte an mir, hatte Angst vor mir selbst: Was, wenn ich mir oder der Kleinen etwas antue? Ich hatte ständig Bilder aus Nachrichten im Kopf, mit ähnlichen Geschichten. Ich fragte mich, ob ich überhaupt hätte Mutter werden sollen – ob das bedeutet, dass ich mein Kind nicht liebe.
Der Zusammenbruch kam eines Abends, als ich diese Gedanken nicht mehr ertragen konnte. Wir riefen das ärztliche Notfalltelefon an, und eine sehr nette Ärztin kam um 2 Uhr nachts zu uns. Sie sprach lange mit mir und empfahl uns, die Mutter-Kind-Klinik in Affoltern zu kontaktieren. Das tat ich natürlich, und eine Woche später war ich dort. Ich fühlte mich, als würde ich unsere Familie zerstören – ich riss meine Tochter dem Vater weg, ich traumatisierte mein Kind – das waren meine Gedanken.
In der Klinik wurde eine leichte bis mittlere Depression diagnostiziert, und man versicherte mir, die Gedanken würden wieder verschwinden. Ich klammerte mich daran. Nach vier Wochen entschied ich mich, wieder nach Hause zu gehen – denn die Gesprächstherapie half mir mit meinen Gedanken nicht weiter, und die Ärzt:innen waren der Meinung, ich sei eigentlich in einem zu guten Zustand und einfach nur überfordert von der Frühgeburt.
Ich konfrontierte meine Angst und begann, alleine mit meiner Tochter zu sein. Aber ich fühlte mich nie wirklich gut – nie wie früher. Ich wusste: Etwas stimmt nicht. Ich war eine ganz „normale“ Frau bis zur Geburt – aber diese Person schien weit weg zu sein.
Meine Hausärztin verschrieb mir eine kleine Dosis Escitalopram (für 1,5 Jahre) – und tatsächlich verbesserte sich mein Zustand. Ich fand teilweise zu meiner alten Version zurück. Die begleitende Gesprächstherapie half mir allerdings nicht viel. Damals wusste ich nicht warum, heute schon: Es war keine passende Therapie für eine Zwangsstörung – schon gar nicht für Zwangsgedanken!
Ich befasste mich immer intensiver mit dem Thema und fand – mit viel Glück – eine Therapeutin, die auf Zwangsstörungen spezialisiert ist. Normalerweise wartet man Monate auf einen solchen Therapieplatz.
Zu Hause überlegten wir lange, ob wir ein zweites Kind möchten. Mein Herz sagte „ja“, meine Angst vor der Zwangsstörung „nein“. Ich wollte nicht nochmals durch diese Hölle – und gleichzeitig wünschte ich mir so sehr ein Geschwisterchen für unsere Tochter. Nach reiflicher Überlegung entschieden wir uns dafür – und ich wurde wieder relativ schnell schwanger. Alles verlief reibungslos: Antidepressiva rechtzeitig abgesetzt, zwei Monate Vaterschaftszeit für meinen Mann, Unterstützung durch Familie organisiert usw.
Unsere zweite Tochter lag in Steisslage – also wurde es wieder eine Sectio. Doch die verlief im August 2024 viel ruhiger und besser als 2021. Ich war voller Hoffnung, dass sich dieses Mal alles anders anfühlen würde.
Aber in der zweiten Nacht im Spital konnte ich nicht schlafen – und voilà: Es fing von vorne an. Ängste wurden getriggert, Erinnerungen an 2021, Zwangsgedanken, Schweissausbrüche von den Hormonen. Ich war fix und fertig. Doch diesmal hatte ich einen Notfallplan mit meiner Therapeutin vorbereitet – und ich hielt mich daran. Bereits am nächsten Tag begann ich wieder mit einer kleinen Dosis Antidepressiva (nach Rücksprache mit Gynäkologe und Psychiaterin). Ich wollte unbedingt vermeiden, dass es schlimmer wird. Vielleicht hätte man mich auffangen können, wenn es Psycholog:innen vor Ort gegeben hätte – aber leider haben viele Spitäler das nicht. Und schon gar nicht Fachpersonen, die sich mit Zwangsstörungen auskennen.
Ich war nicht glücklich darüber, wieder Antidepressiva nehmen zu müssen – besonders weil ich voll stillte. Ich bin sehr dankbar der psychiatrischen Klinik Zürich, die mir so rasch einen Termin gab und mir versicherte, dass ich problemlos weiterstillen könne.
Heute – sieben Wochen nach der zweiten Geburt – geht es mir gut. Nicht super, aber gut. Und ganz sicher nicht so wie 2021.
Ich möchte allen Frauen Mut machen, für sich einzustehen – und nicht aufzugeben, bis sie an der richtigen Stelle angekommen sind. Gerade bei Zwangsstörungen ist das enorm schwer! Viele Therapeut:innen führen sie zwar im Angebot, aber nur wenige kennen sich wirklich gut damit aus – und noch weniger mit Zwangsgedanken.
Falls ihr betroffen seid, kann ich euch ocdland.com sehr empfehlen – meiner Meinung nach eine der besten deutschsprachigen Informationsseiten zu Zwängen.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Gynäkolog:innen, Hebammen und Spitäler genauer hinschauen – damit Frauen frühzeitig Hilfe bekommen und vor dem Schlimmsten bewahrt werden können. Und ich möchte euch Frauen ermutigen: Seid ehrlich zu euch selbst. Holt euch Hilfe. Schluckt diese Beschwerden nicht runter. Es gibt Unterstützung.


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram