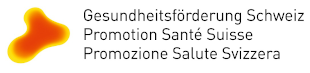Interview mit der Psychologin Helen Hürlimann Welstead zum Thema PPD

Helen Hürlimann Welstead ist Fachpsychologin für Psychotherapie FSP und für Kinder- und Jugendpsychologie FSP sowie ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins Postnatale Depression Schweiz
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art der Geburt und einer Postnatalen Depression (PND)/Postpartalen Depression (PPD)?
Kaiserschnittentbindungen, insbesondere Kaiserschnitte, die notfallmässig durchgeführt werden, weil beispielsweise die Herztöne des Babys abfallen, wegen Plazenta-Problemen oder starker Erschöpfung der Mutter oder auch traumatisch erlebte Geburten, die sehr lange dauern oder während deren sich die Frauen nicht gut betreut fühlen, können sowohl das Risiko für die Entwicklung einer Postpartalen Depression als auch einer posttraumatischen Belastungsstörung erhöhen.
Spielen die weiblichen Hormone bei der Entstehung einer PPD eine Rolle?
Die weiblichen Hormone, insbesondere der starke Hormonabfall nach der Geburt sowie der Milcheinschuss zwischen dem dritten und fünften Tag, sind vermutlich ein Mitauslöser für die Stimmungslabilität in den ersten Tagen nach der Geburt. Bei Frauen mit einer depressiven Vergangenheit kann die hormonelle Umstellung bei der Geburt ein Auslöser für die Entstehung einer PPD sein.
Was ist der Unterschied zwischen einer "normalen" Depression und einer PPD?
Die Postpartale Depression unterscheidet sich bezüglich Symptomen nicht prinzipiell von anderen Depressionen. Es gibt trotzdem Besonderheiten: Die Inhalte des depressiven Grübelns und der Schuldgefühle beziehen sich meist auf das Kind und das Muttersein.
Was ist der Unterschied zwischen Baby Blues und PPD?
Der Baby Blues beschreibt leichte depressive Verstimmungen, eine deutliche Stimmungslabilität und häufiges Weinen sowie Erschöpfung in der ersten Woche nach der Geburt. Dieser postpartale Blues (früher „Heultage“ genannt) wird häufig als „normale“ Folge der hormonellen Umstellung verstanden. Diese Symptome klingen meist innerhalb von Tagen spontan ab, kommen aber bei bis zu 80% der Mütter vor.
Bei der Postpartalen Depression sind die depressiven Verstimmungen anhaltend. Dazu kommt ein Gefühle der inneren Leere, die Unmöglichkeit, sich über das Baby zu freuen, chronische Erschöpfung, Antriebslosigkeit, das Erleben von starker Überforderung , starke Gefühle der Angst, Schuld und Wertlosigkeit. Oft treten zusätzlich Beschwerden wie Appetit- und Schlafveränderungen, wie beispielsweise das wiederholte Aufwachen nachts obwohl das Kind nicht weint, auf.
Die Postpartale Depression tritt im ersten Jahr nach der Geburt auf, meist in den ersten Wochen, und kann Monate bis manchmal über ein Jahr dauern. Die Phasen des Babyblues und der Postpartalen Depression können fliessend ineinander übergehen. Schleichende Entwicklungen sind häufig.
Postpartal können auch Angst- und Zwangserkrankungen auftreten. Wenn die Ängste deutlich übersteigert sind und Panikattacken, beispielsweise wenn man mit dem Kind alleine ist, auftreten, spricht man von einer postpartalen Angsterkrankung. Auch Zwangsgedanken können sehr belastend sein. Frauen haben ständig Angst, dem Kind oder dem Partner passiere etwas, das Kind falle vom Wickeltisch oder sie lasse den Kinderwagen auf der Strasse plötzlich los. Manchmal sind auch Gedanken, man könnte dem Kind etwas antun, allgegenwärtig.
Was ist der Unterschied zwischen einer Erschöpfungs-Depression und PPD?
Bei der Erschöpfungsdepression ist das wesentliche Symptom die chronische Erschöpfung. Der Alltag kann nicht mehr bewältigt werden, es besteht ein unstillbarer Schlafdrang, oder jegliche – auch einfache – Tätigkeiten brauchen einen enormen Energieaufwand. Depressive Verstimmungszustände, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sind weitere psychische Symptome. Eine Abgrenzung zum depressiven Krankheitsbild der PPD ist fast nicht möglich. Sehr oft führen auch Erschöpfungszustände, die sich über einen langen Zeitraum erstrecken und oft mit starkem Schlafmangel verbunden sind, zu einer späteren Depression.
Was sind die Gründe? Gibt es Risikofaktoren?
Aus Untersuchungen ist bis heute einzig gesichert, dass depressive Symptome in der Vorgeschichte der Mütter wie zum Beispiel starke Stimmungsschwankungen in der Pubertät, frühere depressive Krisen nach Beziehungsverlusten oder eine genetische Veranlagung (ein Elternteil oder ein Geschwister ist depressiv) ein erhöhtes Risiko darstellen, an einer Postpartalen Depression zu erkranken.
Neben den körperlichen Faktoren, wie der Veranlagung und den hormonellen Schwankungen, kann es auch psychosoziale Faktoren geben: Zum Beispiel wenig bis keine Unterstützung aus dem eigenen familiären Umfeld, weil vielleicht die eigene Mutter in einem anderen Land wohnt oder weil der Mutter-Tochter-Kontakt schwierig ist. Auch weil kaum Verständnis für die Gefühlslage der Mutter aufgrund mangelnder Sensibilisierung auf Probleme nach der Geburt besteht, führt dies bei der Mutter oft dazu, dass sie versucht, gegen aussen eine (glückliche) Fassade aufrecht zu halten. Auch Paarkonflikte, Konflikte mit der Herkunftsfamilie oder eine soziale Isolation wie nach einem Umzug sind weitere Risikofaktoren.
Genügend Schlaf ist in der Zeit nach der Geburt besonders wichtig. Bei erschöpften Müttern wurden gemäss einer Untersuchung mehr depressive Symptome nachgewiesen, als bei jenen, die angaben, genügend zu schlafen.
Hat die PPD mit unserer Leistungsgesellschaft und Ansprüche an die Mutterrolle zu tun?
Die Frau von heute soll vielen verschiedenen Rollen gleichzeitig gerecht werden: Sie soll nicht nur eine einfühlsame und kompetente Mutter sein, sie soll zudem eigenständig und belastbar, ihrem Partner eine gute Kollegin und Intim-Partnerin sein und möglichst bald wieder erfolgreich in den Beruf einsteigen. Nebenbei soll sie problemlos stillen können und den Haushalt perfekt führen. Schliesslich arbeitet sie nun ja nicht mehr und hat „nur“ ein Kind zu versorgen. Diese Mehrfachbelastungen und neuen Herausforderungen im Familienalltag können starken Erwartungsdruck – von innen und aussen – auslösen, sodass junge Mütter oft zu lange warten, bis sie sich Hilfe holen. In der heutigen Zeit der hochentwickelten medizinischen Möglichkeiten wie beispielsweise beim Thema Kinderwunsch, aber auch beim Geburtsverlauf können bei den Frauen dazu führen, auch nach der Geburt zu denken, dass alles machbar und kontrollierbar sein muss. Auch der Wettbewerb unter Müttern bezüglich Durchschlafen, Sitzen, Krabbeln, Sprechen kann starken Druck und Unsicherheiten auslösen und die Einsamkeitsgefühle noch verstärken.
Gibt es auch Männer, die nach der Geburt des Kindes an Depressionen erkranken?
Ja. In den letzten Jahren wurde dem Thema Vaterschaft vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Leider ist dieser Themenbereich noch wenig erforscht. Es gibt Hinweise darauf, dass Männer drei bis sechs Monate nach der Geburt des Kindes besonders häufig unter Depressionen leiden (ca. 10%). Zudem scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen einer mütterlichen, depressiven Erkrankung sowie einer väterlichen zu geben. Beim Fragebogen zur Befindlichkeit nach der Geburt (siehe www.elternkindzentrum.ch) zeigt sich beim Ausfüllen des Bogens durch beide Elternteile, dass die Symptome bei emotionalen und sozialen Problemen oft ähnlich sind, nur sind diejenigen der Mütter stärker als die der Väter.
Einige Frauen berichten davon, dass sie während der PPD ihr Kind nicht abgeben konnten – hängt das mit PPD zusammen?
Es gibt auch Mütter ohne PPD, die ihr Kind nicht jemandem anvertrauen wollen/können. Vielleicht hat dies eher mit den Ängsten zu tun, dem Kind passiere etwas oder sie hätten dann zu wenig Einfluss auf ihr Kind (Kontrollverlust). Solche Ängste können bei einer Frau mit PPD verstärkt sein.
Empfinden Frauen mit PPD nichts/weniger für ihre Kinder?
Viele Mütter beklagen die fehlende oder sehr ambivalente gefühlsmässige Bindung zu ihrem neugeborenen Kind. Darunter leiden Mütter sehr, was dann zu Selbstvorwürfen und Versagensgefühlen führt. Eine Beruhigung ist es für die Mütter zu erfahren und zu spüren, dass das Baby zwei Elternteile hat, die es umsorgen und dass diese sich gegenseitig ergänzen können. Der Kindsvater ist hierbei eine der wichtigsten Stützen für die erkrankte Frau – nicht selten fühlt dieser sich jedoch selbst überfordert und allein gelassen. Vielen Müttern hilft es zu wissen, dass das Kind nicht zu kurz kommt, auch wenn sie sich zu Beginn nicht am Kind erfreuen kann oder eine innere Leere verspürt. Die Mutter braucht in dieser sensiblen Phase Unterstützung und quasi selbst eine fürsorgliche „Bemutterung“, um sich erholen zu können.
Braucht es Medikamente? Was bewirken sie? Kann man es ohne Medikamente schaffen?
Bei mittelschweren bis schweren Formen der Postpartalen Depression werden in der Regel Antidepressiva verschrieben. Deren Wirkung tritt jedoch meist erst nach drei bis vier Wochen ein. Es gibt heutzutage auch Medikamente, welche in der Schwangerschaft und während des Stillens eingenommen werden können, ohne das Baby zu schädigen. Gewisse Medikamente wirken eher schlaffördernd, andere vermehrt gegen die heftigen Ängste oder die innere Unruhe sowie bei starken depressiven Zuständen.
Ob eine Heilung ohne Medikamente möglich ist, hängt vom Ausprägungsgrad der Depression ab. Bei leichten bis mittelschweren Ausprägungen der Depression können psychotherapeutische Interventionen wie konkrete Besprechungen von Hilfsmöglichkeiten im Alltag, Entspannung bei der Schlafproblematik oder die Herstellung von Kontakten z.B. zu anderen Betroffenen allein wirksam sein. Sehr gut hat sich auch das autogene Training oder die progressive Muskelentspannung bewährt, um wieder ein inneres körperlich-seelisches Gleichgewicht herzustellen.
Einrichtungen für Mütter mit PPD – wo gibt es auf sie zugeschnittene Angebote?
Diese werden in der Schweiz durch spezielle Kliniken, Krisen-Interventions-Zentren oder psychiatrische Abteilungen angeboten – leider gibt es aber noch immer viel zu wenige passende Angebote:
Eine Übersicht der angebotenen Plätze findet sich auf der Website www.postpartale-depression.ch unter Mutter-Kind-Plätze.
Eine gekürzte Version des Interviews ist auch im Migros-Magazin erschienen.


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram