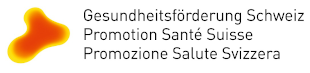Erfahrungsbericht von Vanesa
Mein Name ist Vanesa, ich bin heute 32 Jahre alt, Krankenschwester und Mutter von drei Kindern im Alter von 6 Jahren, 3 Jahren und 10 Monaten.
Ich wollte schon immer Kinder haben. Eine Familie zu gründen war für mich ein Ziel, ein Ziel, das ich um jeden Preis erreichen wollte. Mein Mann und ich bekamen unsere Tochter im Alter von 26 Jahren. Wir waren so glücklich über unsere kleine Prinzessin, dass wir uns keine Gedanken über die zukünftigen Wochen und Monate machten. Und unsere Tochter gab uns Recht: Sie war bezaubernd, ein Vorzeigebaby.
Unser Sohn vergrößerte unsere Familie drei Jahre später. Aber die ersten Monate waren sehr kompliziert: Unser Baby weinte jeden Tag ununterbrochen, es schlief nachts nur in meinen Armen und brauchte ständigen Kontakt. Das erschöpfte mich, aber in dieser Zeit merkte ich es noch nicht, ich konnte einfach nicht aufhören. Mein Mann half mir nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, er war präsent und gleichzeitig abwesend. Ich war an allen Fronten.
"Ich habe in meinem Kopf dieses Bild der perfekten Mutter geschaffen, das ich erreichen musste."
Hinzu kamen meine Erwartungen als Mutter, die mich zum Perfektionismus antrieben und mich ebenfalls erschöpften. Ich hatte in meinem Kopf das Bild der perfekten Mutter geschaffen, die jeden Tag leckere Gerichte zaubert und viel mit ihren Kindern unternimmt. Eine Mutter, die sich um den Haushalt kümmert, während sie gleichzeitig arbeitet und ihre Kinder erzieht. Eine Mutter, die gut gekleidet, perfekt geschminkt ist und keinen vollen Wäschekorb hat. Kurz gesagt, eine Mutter, wie sie in den Medien dargestellt wird. Ich tendierte so sehr zu diesem Ideal, dass ich mich schuldig fühlte und schämte, wenn ich nicht erreichte, was ich mir vorgenommen hatte.
Nach zwei anstrengenden, zermürbenden Jahren vertraute ich meinem Mann an, dass ich erst in einigen Jahren ein drittes Kind haben wollte. Ich möchte mich ausruhen. Ich wollte mich erholen, damit ich mich besser auf unser zukünftiges drittes Baby konzentrieren konnte. Doch die Natur hat anders entschieden: Ich erfuhr im Oktober 2020, dass ich wieder schwanger bin. Diese Schwangerschaft war zwar erwünscht, aber sie kam früher als erwartet. Ich war glücklich, aber ich hatte auch Angst.
Alles lief gut, die Schwangerschaft lief sehr gut. Ich setzte meine Teilzeitarbeit fort, bis ich im siebten Monat war. Unser drittes Baby wurde im Mai 2021 per Kaiserschnitt geboren. Die Anfangszeit war nicht mehr so mühsam wie beim letzten Mal. Die einzigen anspruchsvollen Momente waren die Abende, da unser Sohn an Koliken litt. Abgesehen von den anstrengenden Abenden war er ruhig und unkompliziert. Mit 7-8 Monaten schlief er sogar durch. Während sein grosser Bruder, der zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre alt war, dies noch nicht tat.
"Ich erledigte die täglichen Aufgaben wie ein Roboter. Ich tat nur das, was zum Leben notwendig war. Nicht mehr und nicht weniger. Ich erkannte mich selbst nicht mehr."
Seit drei Jahren wurde ich immer müder, eine starke Müdigkeit, eine starke Erschöpfung. Nach und nach begann ich, weniger Geduld zu haben und meine Kinder immer mehr anzuschreien. Ich litt auch an Schlafstörungen. Ich begann immer weniger Aktivitäten zu unternehmen. Ich ging kaum noch raus: Daran zu denken, was ich alles tun müsste, bevor ich mit den Kindern raus gehe, erschien mir unüberwindbar. Als ob ich den Mount Everest besteigen müsste. Mir fehlte die Motivation und der Lebensmut war verschwunden. Ich lächelte nicht mehr und weinte leise allein im Schlaf- oder Badezimmer. Ich wollte nicht, dass meine Kinder mich so sehen.
Am schlimmsten waren die Gefühle: Unruhe, Angst, Nervosität, innere Anspannung, Schuldgefühle, Traurigkeit. Und an manchen Tagen die Leere. Die innere Leere. Ich erledigte die täglichen Aufgaben wie ein Roboter. Ich tat nur das, was für mein Leben unerlässlich war. Nicht mehr und nicht weniger. Ich erkannte mich selbst nicht mehr. Ich nahm meine Rolle als Mutter nicht mehr wahr, alles war mir lästig geworden.
"Ich fühlte mich schuldig, weil ich die Mutter dieser drei kleinen Engel war. Das haben sie nicht verdient, vor allem nicht unser Jüngster. Ich machte mir so grosse Vorwürfe, dass ich sogar schon sehr dunkle Gedanken hatte."
Und dann brach ich eines Tages zusammen: Mein Sohn hatte den ganzen Tag geweint, die beiden älteren Kinder waren auch sehr unruhig. Als mein Mann nach Hause kommt, bat ich ihn, sich um die Kinder zu kümmern, damit ich rausgehen und frische Luft schnappen konnte. Aber er sagte mir, dass er mit Freunden Fussball spielen gehen will, und er tat es, während ich da sass, gegen das Sofa gelehnt und weinte. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich zitterte, weinte und konnte mich nicht mehr beruhigen. Mein Reflex war, meine kleine Schwester anzurufen, damit sie mir zu Hilfe kommt. Dank ihr ging ich zum ersten Mal zum Arzt. Die Diagnose lautete: Ich leide am elterlichem Burnout, aber vor allem an einer Postpartalen Depression. Ich verstand das nicht, das kann mir doch nicht passieren. Ich schämte mich so, dass ich mich nicht um meine Kinder kümmern konnte. Ich schämte mich zu sagen, dass ich krank bin. Und auch schuldig. Schuldig, dass ich der Aufgabe nicht gewachsen bin, schuldig, dass ich die Mutter dieser drei kleinen Engel bin. Es tat mir leid, ihre Mutter zu sein. Das haben sie nicht verdient, besonders das Nesthäkchen. Ich machte mir solche Vorwürfe, ich sollte ihm keine kranke Mutter zumuten. Er sollte keine Mutter mit Depressionen haben.
Es kam sogar vor, dass ich Suizidgedanken hatte und wollte, dass alles aufhört. Ich hatte keine Selbstmordabsichten aber sehr oft dachte ich, dass es einfacher wäre, wenn ich nicht mehr da wäre. Manchmal stellte ich mir vor, wie ich am Steuer meines Autos auf einer Landstrasse sass, lenke und das Lenkrad loslasse und mir sage, dass das passieren wird, was passieren muss. Dann sah ich die Sitze meiner Kinder auf dem Rücksitz und kam zu mir: Nein, ich habe nicht das Recht, ihnen ihre Mutter vorzuenthalten. Sie brauchen mich, sie brauchen eine Mutter und keine andere Frau kann meine Rolle übernehmen. Ich bin ihre Mutter.
Ich begann mit einer Gesprächstherapie bei einem Psychiater sowie mit einer medikamentösen Behandlung. Das war der Anfang einer langen Behandlung.
Am 31. Dezember 2021, als ich mein Baby in die Notaufnahme bringe, breche ich endgültig zusammen. Die Ärzte beschliessen, mich und mein Baby ins Krankenhaus einzuweisen. Und dieser Krankenhausaufenthalt war ein Elektroschock für meine ganze Familie. Mir wurde bewusst, dass ich an einer Krankheit leide, die im Alltag sehr schwer zu ertragen ist und die nicht spontan und vor allem nicht ohne professionelle Hilfe geheilt werden kann.
"Heute habe ich gelernt, dass meine Kinder keine perfekte Mutter brauchen, sondern nur eine Mutter. Einfach eine Mutter."
Heute fühle ich mich besser. Es wurden viele konkrete Massnahmen ergriffen, um mir zu helfen, mich zu heilen, mich zu entlasten und mir die Möglichkeit zu geben, mich zu erholen: psychiatrische und kinderpsychiatrische Betreuung, 100%ige Kinderbetreuung, Hilfe im Haushalt, Unterstützung durch die engste Familie und finanzielle Unterstützung durch eine Sozialarbeiterin. Ich habe einen langen Weg zurückgelegt, um dorthin zu gelangen, wo ich jetzt stehe. Ich bin mir bewusst, dass ich noch viel Arbeit vor mir habe. Aber ich werde für meine Kinder und meinen Mann kämpfen. Für mein eigenes Wohlergehen.
Und vor allem habe ich heute gelernt, dass meine Kinder keine perfekte Mutter brauchen, sondern einfach nur eine Mutter. Allerdings lerne ich immer noch, wie ich eine ausreichend gute und nicht eine ausgezeichnete Mutter sein kann. Aber ich werde es schaffen. Ich habe die Kraft und die Motivation wiedergefunden, die mir in den letzten Monaten so sehr gefehlt haben.
Heute möchte ich laut und deutlich schreien: Eine Postpartale Depression kann jeden treffen und vor allem nach jeder Schwangerschaft (1., 3. oder 5.). Kein Elternteil sollte sich schämen, um Hilfe zu bitten. Gemeinsam können wir diese Krankheit bekannter machen und gegen das Tabu kämpfen. Sprechen wir darüber und betreiben wir Prävention. Denn je schneller diese Krankheit diagnostiziert wird, desto besser sind ihre Heilungschancen.


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram