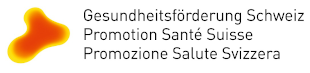Erfahrungsbericht von Nina B.
Rückblickend war meine erste PPD eigentlich keine Überraschung und es ist umso trauriger, dass diese so lange nicht erkannt wurde. Ich gebe hierfür aber niemandem die Schuld, denn ich habe so krampfhaft versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten, dass es von aussen fast unmöglich war, zu erkennen, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Schwangerschaft verlief problemlos, wir zogen allerdings währenddessen in die Schweiz um. Ich erlebte dann direkt vor der Geburt sehr nah den Verlust eines Babys kurz vor dem Stichtag mit und bewegte mich vor und nach der Geburt immer in dem Spannungsfeld zwischen Leben und Tod, und somit in völligem emotionalen Chaos.
Nach einigen Wochen hatte ich aber das Gefühl, alles sei ok. Ich war überzeugt, dass ich alles im Griff hatte, dass ich innerhalb von 6 Monaten wieder „ganz die Alte“ sein würde – körperlich und auch sonst – was ich mir auch als anstrebenswertes Ziel gesetzt hatte. 3 Monate nach der Geburt erlitt meine Mutter einen sehr schweren Autounfall, lag eine Woche im Koma und es war nicht klar, ob und wie sie überleben wird. Ich verbrachte dann gut einen Monat in Deutschland, um bei meiner Familie zu sein und meine Mutter täglich auf der Intensivstation besuchen zu können. Während dieser Zeit stillte ich noch voll und die ganze Situation strapazierte mich ziemlich.
"Ich weinte viel, meist weil mein Sohn mir so unendlich leid tat, dass ich seine Mutter war."
Als ich wieder zu Hause war, fühlte ich mich völlig leer, wollte am liebsten nie wieder aufstehen. Ich hatte weder Kraft noch Motivation für irgendetwas. Ich zwang mich, mit dem Kleinen rauszugehen, hin und wieder etwas zu unternehmen, fühlte mich aber völlig ausgelaugt und emotional abgeschottet. Nach 7 Monaten ging ich wie geplant wieder arbeiten – der Einstieg lief gut, sowohl in der Krippe als auch für mich – und ich funktionierte die folgenden 8 Monate mehr oder weniger. Ich weinte viel, meist weil mein Sohn mir so unendlich leid tat, dass ich seine Mutter war. Ich war mir sicher, dass er sich genauso allein und hoffnungslos wie ich fühlen würde, und dass ich nichts dagegen tun konnte.
Etwa 15 Monate nach der Geburt diagnostizierte der Hausarzt eine Depression. Ich war einerseits schockiert – und andererseits, relativ kurz danach, auch erleichtert. Er schrieb mich für mehrere Wochen krank und ich begann mit einer Körper-Psychotherapie. Diese war der Schlüssel für mich – in meinem Körper waren die Symptome und die aufgestauten Emotionen glasklar und nicht mehr zu ignorieren oder weg zu analysieren. Die innere Unruhe war inzwischen extrem und meine Angst davor, mich dem zu stellen, was da in mir vorging, riesengross. Die Therapie half mir sehr, war aber gerade in den ersten Monaten auch extrem anstrengend und intensiv. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass ich einfach vom Erdboden verschwinden könnte – damit ich die gefühlt unerträglich schwere Last, die mich ständig begleitete, nicht mehr tragen müsste. Nie dachte ich daran, mir etwas anzutun – aber der Wunsch, dass ich und meine ganze Existenz sich in Luft auflösen könnten, begleitete mich ständig und gab mir häufig Schuldgefühle.
Diagnose PPD war eine Erleichterung
Lange war ich sicher, dass ich nie wieder schwanger werden könnte, da ich eine erneute Krise nicht überleben würde. Nach ca. 8 Monaten Therapie fühlte ich mich aber wieder etwas stabiler und wir entschieden uns, es doch nochmals zu probieren. Wieder wurde ich schnell schwanger. In der 7. Woche fand ich heraus, dass es Zwillinge waren. Dies war eine völlige Überraschung und bedeutete natürlich neue Sorgen und Ängste. Zudem lernte ich schnell, dass die Menschen v.a. mit Schock und Mitleid reagieren anstatt mit Freude, wenn sie hören, dass man Zwillinge bekommt. So hatte ich – sowohl im näheren Umfeld als auch darüber hinaus – während der Schwangerschaft viele unangenehme und schmerzhafte Erfahrungen.
Zudem war es körperlich eine extreme Situation. Ich verbrachte zu Beginn der Schwangerschaft 4 Wochen im Spital, da ich konstant erbrechen musste. Als die Zwillinge dann zum von den Ärzten „deklarierten“ Stichtag (38 Wochen) nicht kamen, wurden über die kommenden 2 Wochen zwei Einleitungsversuche gemacht, was jeweils mehr als 20 Stunden Wehen bedeutete. Am offiziellen Stichtag klappte dann der dritte Einleitungsversuch – es war klar, dass ansonsten ein Kaiserschnitt gemacht würde, da die Ärzte nicht länger warten wollten. Unser Sohn kam, als zweiter der Zwillinge, nach sehr intensiver und traumatischer Geburt leblos auf die Welt. Nach Atemunterstützung und Infusion erholte er sich zum Glück schnell.
Ich verbrachte 5 Nächte im Spital, wo ich sehr gut umsorgt wurde, und ich fühlte mich nach der Heimkehr erstaunlich gut. Ich nahm viele Termine wahr und fühlte mich oft misstrauisch: war es möglich, dass es mir nach allem, was gewesen war, so gut ging? Nach 3 Monaten konnte ich plötzlich nur noch weinen. Auf Drängen meines Mannes hin kontaktierte ich die Hebamme, die mich zu meiner Psychologin schickte. Sie machte mit mir den EPDS-Fragebogen und organisierte direkt pflanzliche Medikamente, da ich noch stillte und diverse Bluttests. Die Diagnose „Postpartale Depression“ war diesmal eine absolute Erleichterung – und schnell wurde mir klar, dass ich eine solche auch schon nach der ersten Geburt gehabt hatte.
Das kommende Jahr ging ich wöchentlich in die Therapie, organisierte Kinderbetreuung für mehrere Tage pro Woche, ging zur Akupunktur, Osteopathie und vielem mehr. Und doch fühlte ich mich hoffnungslos, zweifelte immer wieder an mir („vielleicht stelle ich mich nur an und bin gar nicht krank?“) und konnte nicht glauben, dass ich mich irgendwann wieder gut fühlen würde. Die Situation wurde erschwert durch einen schwierigen Kampf mit der Krankentaggeldversicherung, deren Gutachter mehrfach attestierten, dass ich gesund sei. Auch geriet ich mehrmals an sehr unsensible Fachpersonen (Hebamme, Arzt, …), was mitten in der Krise jeweils ein heftiger Rückschlag bedeutete. Auch dieses Mal begleitete mich die Fantasie, wie erlösend es wäre, wenn ich einfach verschwinden könnte – und, dass dies sowohl für mich, als auch für alle anderen letztendlich eine Entlastung darstellen würde.
"Dankbar, dass ich jetzt dort sein und gesund werden konnte"
Als ich etwa 14 Monate nach Geburt der Zwillinge meine erste Panikattacke hatte, entschied ich spontan, dass es jetzt Zeit für einen stationären Aufenthalt war. Dieser war von meiner Therapeutin von Anfang an als Option erwähnt worden, schien mir aber immer nur als eine Art „letzter Schritt“ wirklich realistisch. Einen Monat später begann ich eine psychosomatische Rehabilitation in der Klinik Oberwaid in St. Gallen. Die Entscheidung und Planung des Aufenthaltes, ohne die Kinder, war sowohl emotional als auch praktisch und logistisch sehr schwierig. Ich befürchtete, dass ich nach der Ankunft dort völlig zusammenbrechen würde.
Auch war ich unendlich traurig, die Kinder „zurückzulassen“ – wobei mit den Eltern meines Mannes vor Ort, verschiedenen Freunden und Bekannten, die aushalfen und der Krippe, wo alle gut eingewöhnt waren, alles so gut wie möglich organisiert war. Jeden Morgen würden wir uns beim Frühstück via FaceTime sehen, so dass ich noch einen kleinen Anteil am Familienleben haben konnte. Als ich ihm wenige Tage vor meinem Aufenthalt sagte, wie traurig es mich machte, dass ich ihn und seine Geschwister dann so lange nicht sehen würde, antwortete mir unser grosser Sohn, der damals knapp 4 war, mit einem für mich sehr beruhigenden und heilsamen Satz: „Aber wir sehen uns doch??!!“ Mir zeigte das, dass wir alles ausreichend vorbereitet hatten und es für die Kinder klar war, was auf sie zukam.
Als ich in der Klinik ankam, fiel nach einer ersten Eingewöhnungsphase ein riesiger Ballast von mir ab. Der sichere Rahmen und das vielfältige Therapie-, Bewegungs-, Entspannungs- und Kreativprogramm liessen mich endlich zur Ruhe kommen. Nun da ich nur für mich verantwortlich war, konnte ich irgendwann aufatmen und mich wirklich mit mir und meiner Krankheit auseinandersetzen. Jeden Morgen hatten wir einen schönen und fröhlichen Austausch, der mir immer wieder versicherte, dass dies jetzt das Richtige für mich – und für unsere ganze Familie – war. Ich dachte natürlich viel an meine Kinder und meinen Mann – war aber eigentlich nie traurig, sondern vor allem dankbar, dass ich jetzt dort sein und gesund werden konnte, und dass dies von allen so mitgetragen wurde.
Ich verliess die Klinik nach 5,5 Wochen und fühlte mich beinahe wie ein neuer Mensch. Der Einstieg in den Alltag war herausfordernd, aber ich fühlte mich endlich wieder fähig, mich dem zu stellen und achtsam, und in meinem Tempo, meinen Weg zu finden. Auch auf Basis der langen Therapie im Vorhinein war die Zeit in der Oberwaid für mich wirklich ein Durchbruch – und für meine Situation damals der einzig richtige Entscheid. Ich ging natürlich auch anschliessend weiterhin regelmässig in Therapie und begann erst nach einiger Zeit, meine Medikamente langsam abzusetzen. Es war ein langer, schwerer und zermürbender Weg, der mich aber schlussendlich näher zu mir brachte.
Nachdem ich diese schwierigen Jahre hinter mir gelassen habe, sind mir vor allem 2 Sachen sehr bewusst:
Ich kenne und fühle mich heute besser als jemals zuvor in meinem Leben und bin somit auch dankbar für alles, was mich dahin gebracht hat.
UND
Alle (werdenden) Mütter und Väter sollten Zugang zu Unterstützung und Begleitung haben – offener Umgang mit dem Thema der psychischen Gesundheit rund um die Geburt, Prävention und achtsame Begleitung sind aus meiner Sicht der Schlüssel, um mehr Menschen dieses Leid zu ersparen.

Bild: Nina hat den Weg heraus aus der Krise geschafft und arbeitet seit März 2021 bei uns im Vorstand mit. Ihr liegen die vermehrte Aufklärung zum Thema PPD im Allgemeinen sowie spezifische Unterstützungsangebote für Mehrlingseltern besonders am Herzen.


 Facebook
Facebook Instagram
Instagram