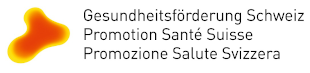Erfahrungsbericht von Annika
Meine erste Schwangerschaft und die Geburt verliefen rückblickend wie im Bilderbuch. Juri war ein Wunschkind, das wir von unserer Reise durch Französisch Polynesien mitbrachten. Welch ein Traum, die Südseeperle. Die Schwangerschaft verlief problemlos, die Wassergeburt war so wie ich es mir vorgestellt hatte. Der erste Schock kam an dem Tag, an dem meine Brüste gefühlt so gross wie Fussbälle wurden und die Milch floss. Die nächsten zwei Wochen erlebte ich dann den Babyblues, war sehr unsicher im Umgang mit dem Baby, gewöhnte mich dann aber schnell an die neue Rolle und wir meisterten die Umstellung auch als Paar. “We are family!” Nach 1.5 Jahren entstand der Wunsch nach einem Geschwisterkind. Leider verloren wir auf tragische Weise unsere Nummer 2 in der 16. SSW und an diesem Punkt schloss sich das Bilderbuch für ein paar Jahre.
Wiedereinsetzen der Menstruation brachte alles zum Wanken
Nach drei Jahren, vielen emotionalen Hochs und Tiefs, Panikattacken und einer langen Reise, wurde ich endlich wieder schwanger und dachte, nun ist es geschafft: das Schlimmste liegt hinter dir. Die Schwangerschaft mit meiner Tochter Mila war aber dann doch ganz anders, ich hatte stets Angst, sie zu verlieren, Angst vor der Geburt, Angst vor der Herausforderung mit zwei Kindern. Dann war sie endlich da und jetzt war doch wirklich alles geschafft. Die ersten Monate hatte ich auch keine Angst mehr, wähnte mich in Sicherheit und stürzte mich in die Arbeit als Doppelmama, Haus- und Ehefrau. Der Tag, an dem meine Menstruation wiederkam, veränderte schlagartig diese Idylle. Während meiner morgendlichen Sit-ups, wurde mir plötzlich schwindelig. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment, ich hatte in der Schwangerschaft oft Angst vor Schwindel, hatte aber nie welchen – jetzt hatte ich ihn wirklich. Von da an wurde er mein ständiger Begleiter. Die Wohnung schwankte, wenn ich im Bett lag, es schaukelte hin und her, ich wachte in der Nacht auf und wusste nicht mehr, wo oben und unten war. Und ich hatte ein fünf Monate altes Baby und einen Fünfjährigen, mit denen ich vier Tage die Woche allein zu hause war. Jede und jeder kann sich vermutlich vorstellen, was für Ängste in mir hoch kamen, als der Schwindel einfach jeden Tag da war. Es wurde ein Lagerungsschwindel diagnostiziert, verursacht durch Stress und Schlafmangel. Das klang für mich logisch. Auch meine Hebamme meinte, es wäre ihrer Meinung nach keine Postpartale Depression, als ich sie zu einem Gespräch nach Hause einlud, ich solle mich schonen.
Den ganzen Sommer ging ich zum Training gegen den Schwindel, der wurde weniger, aber die Angst blieb. Sie holte mich nachts ein, beim Einkaufen, allein mit den Kindern. Als ich nach dem Mutterschaftsurlaub wieder in den Beruf einstieg, kippte es dann völlig. Aufgrund der immer häufiger werdenen Panikattacken hatte ich mir in Absprache mit meiner Hausärztin eine Therapeutin gesucht. Wir sprachen viel über meine Kindheit, die Beziehung zu meiner Mutter. All das brachte mich aber noch mehr aus dem Gleichgewicht. Aber die Diagnose Postpartale Depression fiel hier nie. Ich wusste einfach nicht, warum es mir auf einmal so schlecht ging. Warum mir alles zuviel wurde. Wickeln, Gläschen geben, mit den Kindern sein. Ich kämpfte jeden Tag mit Panikattacken, mit Schwindel, mit meinem Partner, hatte Sehstörungen, ass nicht mehr, konnte nicht mehr schlafen. Ich reduzierte mein Pensum, um einen Totalausfall zu vermeiden, wie ich meinem Chef sagte. Ich wollte nur noch raus aus dieser Situation, weg von allem. Es kamen Gewaltphantasien gegen mich dazu.
“In Affoltern wird alles wieder gut”
Bei einem Lunch mit einem Kollegen brach ich in Tränen aus. Ich war einfach am Ende meiner Kräfte und konnte das alles nicht mehr aushalten. Er erzählte mir von der Frau seines besten Kollegen. Sie sei an einer Postpartalen Depression erkrankt und 8 Wochen auf einer Mutter-Kind-Station gewesen. Das habe ihr sehr geholfen. Zum ersten Mal hörte ich von einem Laien (!) eine Diagnose, die ich sofort annehmen konnte. Die Postpartale oder in der Umgangssprache auch Postnatale Depression genannt, hatte aber nicht erst nach der Geburt meiner Tochter eingesetzt, sondern bereits nach meiner Fehlgeburt. Weder die Ärztin im Krankenhaus damals, noch meine behandelnde Gynäkologin hatten das mit mir angeschaut. Die Folgeschwangerschaft verstärkte einige Symptome, völlig brach die Krankheit dann nach der Rückkehr meiner Menstruation aus. All das wurde mir aber erst während meines 8-wöchigen stationären Aufenthaltes auf der MuKi-Station am Spital Affoltern von meiner dort behandelnden Psychiaterin aufgezeigt.
Ich traf die Kollegin, von der mir erzählt wurde, und nachdem ich kurz von meiner Situation offen erzählen konnte, sagte sie, “Du musst nach Affoltern. Nur dort kommst du aus dieser Situation wieder heraus.” Wir kannten uns gerade mal diese fünf Minuten und sie nahm sofort das Telefon in die Hand und rief auf der Station an, um zu fragen, ob wir vorbeikommen könnten. Das war mein erster Besuch in einer psychiatrischen Abteilung und ich hatte jegliche Vorurteile in meinem Kopf. Wir wurden sehr herzlich empfangen und die Leiterin Frau Duray zeigte uns spontan die Station. 9 Zimmer, nett eingerichtet, eine Gemeinschaftsküche, ein Essensraum mit Spielecke, das Schwesternzimmer. In mir wechselten sich während der Besichtigung Panik und Hoffnung ab. Panik, vor dem was kommt, wie sollte mein fünfjähriger Sohn versorgt werden, wenn mein Mann vier Tage die Woche beruflich bedingt abwesend war? Wie wird das Umfeld reagieren, wenn sie hören, dass ich in einer Klinik bin? Geht es dir wirklich so schlecht, dass du das hier jetzt machen musst? Auf der anderen Seite sah ich die strahlende Kollegin, die sich freute, an diesen Ort zurückzukommen. Die mir versicherte, es sei eine temporäre Krankheit, die wieder vergeht. Alles wird wieder gut hier in Affoltern, meinte sie.
Bild: "Nach Affoltern zu gehen war gleichzeitig die beste aber auch die schwierigste Entscheidung für mich." Annika und ihre Tochter verbrachten insgesamt 8 Wochen auf der Mutter-Kind-Station des Spital Affoltern.
Zurück von meinem Besuch auf der Mutter-Kind-Station drehten sich meine Gedanken und Gefühle permanent um Affoltern als ginge es um mein Leben. Als mein Mann an diesem Nachmittag zuhause auf mich wartete, erzählte ich ihm von meiner Besichtigung und er sagte sofort, wenn du denkst, dass das dir helfen kann, mach es. In diesem Moment fiel die Entscheidung. Telefonisch bestätigte ich bei Frau Duray meinen Wunsch, einen unbestimmten Aufenthalt in Affoltern zu beginnen. Meine Hausärztin schrieb sofort die Überweisung aus und mit richtig viel Glück war ich nur eine Woche später in Affoltern.
Wir konnten eine gute Lösung für meinen Sohn im Freundes- und Nachbarschaftskreis finden, auch der Arbeitgeber meines Mannes unterstützte uns mit zusätzlichen Freitagen. Aber als ich dann mit meiner Tochter allein in meinem Zimmer auf der Station sass, brach alles in mir zusammen. Ich dachte: “Das ist der absolute Tiefpunkt deines Lebens. Du bist jetzt in der Psychiatrie.” Die ersten Wochen waren sehr schwer für mich. Die Trennung von meinem Sohn, die Umstellung auf den Alltag auf der Station, die beginnende Behandlung. Es gab für mich in dieser Zeit nur einen Lichtblick: die anderen Mütter, die alle in der gleichen oder einer ähnlich schwierigen Situation steckten. Mütter, denen das Muttersein auch Probleme gebracht hatte, denen es schlecht ging, die weinten, schwiegen und nicht wussten, was noch kommen würde. Genau diese offenen und ehrlichen Gespräche, die gemeinsamen Spaziergänge, das Gefühl, nicht mehr allein mit der Situation zu sein, haben mir geholfen, mich mit meiner Postpartalen Depression auseinander zu setzen und sie zu akzeptieren. Ich lernte in Affoltern die Hintergründe und Zusammenhänge kennen, ich lernte, wie ich mit den Symptomen umgehen kann, was mir gut und was mir nicht gut tut.
Meine Tochter wurde von 09:00 bis 15:00 Uhr in der Stationskrippe liebevoll betreut. Während dieser Zeit konnte ich verschiedene Therapieangebote nutzen. Sport, Physiotherapie, Bewegung mit Musik, Basteln für und mit den Kids, Gruppengespräche mit den anderen Müttern, Gesprächstherapie zweimal wöchentlich und medikamentöse Beratung. Bis zu meinem Eintritt hatte mir mein Psychiater nie unterstützende Medikamente vorgeschlagen. Ich hatte nur von meiner Hausärztin "Temesta" bekommen, dass aber nur punktuell eingenommen werden kann, da es zu einer Abhängingkeit führen kann.
Nachmittags und abends war dann das Kind bei mir. Mit zwei Müttern verstand ich mich besonders gut und es entwickelte sich eine Freundschaft. Wir teilten Gedanken aus der Therapie, sprachen über das, was wir empfanden, wir verstanden die Gefühle und motivierten uns gegenseitig, wenn es der anderen nicht gut ging. Wir hörten einander zu und waren füreinander da. Aber wir lachten auch. Wir erzählten uns viel aus unserem bisherigen Leben und nahmen es so, wie es nun einmal war. Nach und nach ging es jeder von uns besser. Bei mir dauerte es ungefähr vier Wochen, bis ich wieder ruhiger wurde, bis die Medikamente wirkten, bis ich wieder schlafen konnte und auch essen mochte. Die Panikattacken verschwanden nach und nach, der Schwindel verflog langsam und ich fühlte mich endlich endlich besser. In der nächsten Zeit dachte ich viel über meinen Job, meine Beziehung und mein Leben nach. Was wollte ich nach dem Aufenthalt ändern? So langsam blickte ich vorsichtig nach vorn.
Zeit für mich, Kinderbetreuung, ambulante Therapie:
So stabilisierte sich alles
Nach knapp 8 Wochen verliess ich Affoltern mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite freute ich mich wahnsinnig auf die Nähe meines Sohnes, auf die Eigenständigkeit, auf mein Zuhause und das echte Leben, auf der anderen Seite hatte ich Angst, dass alles wiederkommt. Dass es mich schnell wieder einholt. Aber dem war nicht so. Ich hatte gelernt, die Symptome der Krankheit zu erkennen, meine persönlichen Auslöser zu ändern und ich hatte viel Kraft getankt. Die ersten beiden Monate hatte ich noch Unterstützung im Haushalt, um viel Zeit für mich zu haben. Ich hatte mir vorgenommen nur Dinge zu machen, die mir Spass machten. Da ich die Kinderbetreuung für meine Tochter in unserer alten Krippe wieder aufnehmen konnte, bekam ich genügend Zeit für mich. Endlich klebte ich mit Freude Fotoalben und sah Serien auf Netflix. Mich begleitete eine neue Therapeutin nach dem Aufenhalt und ich nahm die Medikamente ein ganzes Jahr weiter, um nicht wieder in die Depression zu rutschen. Der Klinikaufenthalt hat mir im Rückblick die nötige Kraft und Zuversicht gebracht, die Krankheit zu überwinden und es war die beste Entscheidung für mich gewesen.
Seit März 2019 arbeite ich als Geschäftsstellenleiterin beim Verein Postpartale Depression Schweiz und berate andere Betroffene mit meinen persönlichen Erfahrungen und meinem über die Zeit erworbenen Fachwissen. Ich bin sehr dankbar für diese sinnstiftende Aufgabe und möchte bewirken, dass Postpartale Depressionen künftig besser und schneller erkannt werden kann, dass es genügend Hilfsangebote für betroffene Mütter und auch Väter in der Schweiz gibt und dass man als Betroffene oder Betroffener ohne Angst über seine Situation sprechen kann, denn es kann passieren, dass es dir nach der Geburt schlecht geht, ohne das du etwas dafür kannst!



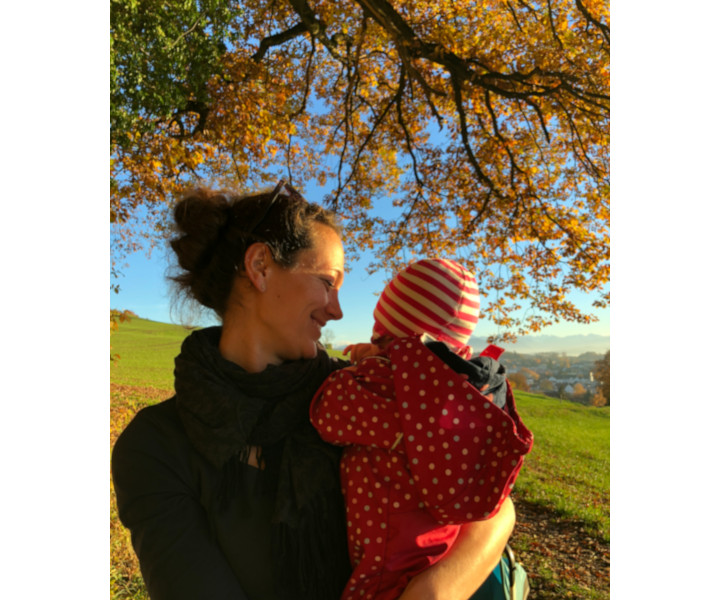
 Facebook
Facebook Instagram
Instagram